Patriarch
von
Moskau
und
der
ganzen
Rus'
Aleksij
II.:
Osterbotschaft
Bischof
Hilarion
von
Wien
und
Österreich:
Osterbotschaft
Bischof
Hilarion
von
Wien
und
Österreich:
Ostern
ist
immer
Philipp
Harnoncourt:
Auf
dem
Weg
zum
leeren
Grab
Wiener Alt-Erzbischof und Brückenbauer nach Osten
Franz Kardinal König gestorben
KATHOLISCHE PRESSEAGENTUR: www.kathpress.at
Orthodoxe Christen gedachten Kardinal Königs im Stephansdom
Wien, 28.3.04 (KAP) Im Zeichen der Dankbarkeit für die "vorbildliche, einmalige und großartige ökumenische Pionierarbeit" Kardinal Königs stand am Freitagnachmittag ein orthodoxes Totengedenken am Sarg des verstorbenen Alterzbischofs im Wiener Stephansdom.
An dem Totengedenken wirkten mit Metropolit Michael Staikos und dem russisch-orthodoxen Bischof Hilarion (Alfejew) an der Spitze alle orthodoxen Seelsorger Wiens mit.
Kardinal Christoph Schönborn war bei dem Totengedenken anwesend.Die Gebete und Gesänge erklangen in den verschiedenen Sprachen der orthodoxen Gemeinden, aber auch auf deutsch. Das Vaterunser wurde gemeinsam gebetet.
Es war das erste Mal, dass in Europa am Sarg eines katholischen Bischofs ein orthodoxes Totengedenken stattfand.
Außergewöhnlich war auch das Zusammenwirken aller orthodoxen Kirchen, angefangen von den Kirchen von Konstantinopel und Moskau.
"Dieses Gedenken war ganz im Geist Kardinal Königs“ fasste treffend die Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, Oberin Christine Gleixner zusammen.
KATHOLISCHE PRESSEAGENTUR: www.kathpress.at
Der Erzbischof von Wien Kardinal
Christoph Schönborn besuchte die russisch-orthodoxe Kathedrale
des
Hl. Nikolaus in Wien
 Am 7. Jänner 2004, dem Fest der Geburt Christi,
besuchte der Erzbischof von Wien Kardinal Christoph Schönborn die Kathedrale
des
Hl. Nikolaus in Wien. Am Kircheneingang wurde er vom Vertreter der
Russischen Orthodoxen Kirche bei den europäischen Internationalen
Organisationen, dem Bischof von Wien und Österreich Hilarion begrüßt. Der
Kardinal wurde zur linken Chorrampe geleitet, von wo er der Göttlichen Liturgie
folgte, die Bischof Hilarion in Konzelebration mit dem Pfarrer der Kathedrale
Erzpriester Vladimir Tyschuk und den Kathedralklerikern Erzpriester
Chrysostomos Pijnenburg und Priester Radoslav Ristic und dem Kleriker der
Kathedrale zu Mariä Entschlafung in Budapest Diakon Kyrill Tatarka feierte. Vor
dem Beginn des eucharistischen Kanons tauschten Kardinal Schönborn und Bischof
Hilarion den Friedenskuss aus.
Am 7. Jänner 2004, dem Fest der Geburt Christi,
besuchte der Erzbischof von Wien Kardinal Christoph Schönborn die Kathedrale
des
Hl. Nikolaus in Wien. Am Kircheneingang wurde er vom Vertreter der
Russischen Orthodoxen Kirche bei den europäischen Internationalen
Organisationen, dem Bischof von Wien und Österreich Hilarion begrüßt. Der
Kardinal wurde zur linken Chorrampe geleitet, von wo er der Göttlichen Liturgie
folgte, die Bischof Hilarion in Konzelebration mit dem Pfarrer der Kathedrale
Erzpriester Vladimir Tyschuk und den Kathedralklerikern Erzpriester
Chrysostomos Pijnenburg und Priester Radoslav Ristic und dem Kleriker der
Kathedrale zu Mariä Entschlafung in Budapest Diakon Kyrill Tatarka feierte. Vor
dem Beginn des eucharistischen Kanons tauschten Kardinal Schönborn und Bischof
Hilarion den Friedenskuss aus.
Nach dem Entlassungsgebet der Göttlichen
Liturgie wandte sich Bischof Hilarion in seinem Namen und im Namen der
Pfarrangehörigen der Kathedrale zum hl. Nikolaus mit einem Grußwort in
deutscher Sprache an den hohen Gast. Kardinal Schönborn begrüßte seinerseits
Bischof Hilarion und seine Herde herzlich. (Die Grußworte sind unten
beigefügt.)
Nach Beendigung des Gottesdienstes wurde im Refektorium der Kathedrale ein Mittagessen gegeben, während dessen das Oberhaupt der Wiener Erzdiözese der Römisch-Katholischen Kirche die Möglichkeit hatte, sich mit den Klerikern und den Gläubigen der Diözese von Wien und Österreich der Russischen Orthodoxen Kirche zu unterhalten.
Grußwort
des Bischofs Hilarion
an den Erzbischof von Wien Kardinal Christoph Schönborn
aus Anlass seines Besuches in der Russischen orthodoxen
Kathedrale
des
Hl.
Nikolaus am 7. Januar 2004
 Eure
Eminenz!
Eure
Eminenz!
In meinem Namen und im Namen der Russisch-orthodoxen
Gemeinde Österreichs begrüße ich Sie herzlich in diesem heiligen Gotteshaus,
der Kathedralkirche der Diözese von Wien und Österreich des Moskauer
Patriarchats. Diese am Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Kirche ist bis
heute eine der architektonischen Sehenswürdigkeiten Wiens. Obwohl sich die
Kirche auf dem Territorium der Russischen Botschaft befindet, sind die
Pfarrangehörigen nicht nur Russen, sondern auch Ukrainer, Belorussen, Moldawer,
Georgier, Österreicher und Vertreter anderer Nationalitäten. Das hängt in
erster Linie mit dem multinationalen Charakter der Russischen Orthodoxen Kirche
selbst zusammen, die mehr als einhundert Millionen orthodoxe Christen
vereinigt, die in verschiedenen Ländern leben und verschiedene Sprachen
sprechen.
Heute feiert unsere Kirche das Fest der
Geburt Christi. „Heute ist Gott auf die Erde gekommen, und der Mensch ist in
den Himmel gestiegen“, heißt es in einem Kirchenlied. Gott wurde Mensch, um uns
den Weg in den Himmel zu eröffnen, um unser Leben mit neuem Inhalt zu füllen
und um uns Hoffnung auf Heil zu schenken. Wir haben heute auch darum gebetet,
dass jeder von uns Teilhaber an diesem großen und verborgenen Heilsgeheimnis
werde, das durch das in Bethlehem geborene Christuskind geoffenbart wurde.
Wir haben auch unser inständiges Gebet um den
Frieden auf der ganzen Welt, um den Wohlbestand der heiligen Kirchen Gottes und
um die Vereinigung aller verrichtet. Zwei Jahrtausende sind nach der Geburt
Christi vergangen, aber auf der Erde gibt es nichts Ersehnteres als den
Frieden: Viele Länder, darunter auch das Heimatland unseres Erlösers, sind
weiterhin eine Arena kriegerischer Konflikte. Fast eintausend Jahre sind
vergangen seit der tragischen Spaltung zwischen den Christen des Ostens und
Westens, und die Einheit der christlichen Welt ist noch immer nicht wiederhergestellt.
Wir sind betrübt darüber, aber wir glauben daran, dass der Herr imstande ist,
die zwischen den Menschen errichteten Barrieren niederzureißen. Wir sind dessen
eingedenk, dass das Streben nach Überwindung der existierenden Trennungen, nach
Wiederherstellung der Einheit der Kirchen und nach Schaffung einer Atmosphäre
des Vertrauens unter den Christen der verschiedenen Konfessionen unsere
unmittelbare Pflicht ist.
Das „österreichische Modell“ der
zwischenchristlichen Zusammenarbeit kann für viele Regionen der Welt als
Beispiel dienen, in denen das Niveau des gegenseitigen Verständnisses von
Orthodoxen und Katholiken bedeutend niedriger ist. Einen bedeutsamen Beitrag
zur Schaffung dieses Modells hat Ihr Vorgänger Kardinal Franz König geleistet, dessen
Werk Sie, Eminenz, in würdiger Weise fortsetzen. Als einer der führenden
Hierarchen der Römisch-Katholischen Kirche empfinden Sie gleichzeitig auch eine
tiefe Liebe zur Orthodoxie, was nicht nur Ihre kirchliche Tätigkeit zeigt,
sondern auch Ihre theologischen Werke, die der Tradition der Ostkirche gewidmet
und in der orthodoxen Welt weit bekannt sind.
Erlauben Sie mir, Eure Eminenz, Sie zum Schluss zum Fest zu beglückwünschen, für Ihren Besuch zu danken und Ihnen die kraftvolle Hilfe Gottes im Dienst der Kirche und im Werk der christlichen Einheit zu wünschen. Unser in Bethlehem geborene Herr Jesus Christus bewahre Sie auf viele und gute Jahre!
Ansprache
Seiner
Eminenz
des
Erzbischofs
von
Wien
Kardinal
Dr.
Christoph
Schönborn
in
der
russisch-orthodoxen
Kathedrale
des
Hl.
Nikolaus
in
Wien
am
7.
Jänner
2004
 Vladyko,
liebe Brüder und Schwestern!
Vladyko,
liebe Brüder und Schwestern!
Christus ist geboren als kleines Kind in
einem armen Stall in Bethlehem. Gott hat sich so klein gemacht, um bei uns zu
sein. Das muss unser Herz bewegen, wenn Gott so demütig ist, dass auch wir
miteinander demütig sind. Wenn Gott so barmherzig ist mit uns, dann müssen auch
wir miteinander barmherzig sein. Der hl. Maximus hat gesagt: „Nichts kann das
menschliche Herz mehr bewegen als die Barmherzigkeit und die Demut Gottes.“
Die Spaltung zwischen unseren Kirchen ist oft
auch das Ergebnis unserer menschlichen Sünden. Und deshalb dürfen wir, wenn wir
bei der Krippe von Bethlehem miteinander beten, nur Gott bitten, dass Er uns
unsere Sünden verzeiht und dass wir neu lernen, miteinander barmherzig zu sein,
auch zwischen unseren Kirchen, dass Wahrheit und Liebe sich umarmen, wie der
Psalm sagt. Und in diesem Sinne, Vladyko, freut es mich, dass wir heute
einander den Friedensgruß geben durften. Möge dieses Zeichen auch ein Zeichen
der Hoffnung sein.
Ich darf Sie, Vladyko, bitten, Seiner
Heiligkeit dem Patriarchen Aleksij meine herzlichen und ergebenen
Weihnachtsgrüße zu übermitteln. Und auch Ihnen sage ich für Ihren Dienst in
Wien und in Österreich ad multos annos – mnogaja leta, Vladyko. Und allen ein
gesegnetes, freudiges, ja auch fröhliches Weihnachtsfest!
Franz Kardinal König ist
in der Nacht auf Samstag, 13. März, gestorben. Der Wiener Alterzbischof, der im
99. Lebensjahr stand, starb gegen drei Uhr im Schlaf.
Geboren am 3. August
1905 als ältester Sohn einer Bauernfamilie in Warth bei Rabenstein an der Pielach
in der Diözese St. Pölten, besuchte Franz König das Stiftsgymnasium Melk, wo er
1927 die Matura mit Auszeichnung ablegte.
Im Herbst 1927 begann er
sein Studium der Philosophie und der Theologie an der Päpstlichen Universität
Gregoriana, sowie altpersische Religion und Sprachen an der Orientalistischen
Fakultät des Päpstlichen Bibelinstitutes in Rom. 1930 wurde er zum Dr.phil.
promoviert und am 29. Oktober 1933 in Rom zum Priester geweiht. Von 1934 bis
1937 war er in seiner Heimatdiözese als Kaplan in Altpölla, Neuhofen an der
Ybbs, St. Valentin und Scheibbs in der praktischen Seelsorge an der Basis
tätig. In dieser Zeit vollendete er auch seine theologischen Studien und wurde
1936 zum Dr.theol. promoviert. Ab 1938 war König Domkurat in St. Pölten und Jugendseelsorger
der Diözese. Ein besonderes Anliegen war ihm die Kriegsgefangenenseelsorge, bei
der ihm seine Russischkenntnisse sehr hilfreich.
1945 wurde er
Religionsprofessor in Krems und habilitierte sich in Wien als Privatdozent für
Religionswissenschaften im Rahmen des Faches der alttestamentlichen
Wissenschaften. König ist bis heute einer der besten Kenner der Ideenwelt der
altiranischen Religion des Zarathustra. 1947 erschien sein Buch "Das Alte
Testament und die altorientalischen Religionen". 1948 erfolgte die
Berufung als außerordentlicher Professor für Moraltheologie nach Salzburg. Hier
leistete er die Hauptarbeit an dem großen religionsgeschichtlichen Werk
"Christus und die Religionen der Erde" (1951), das als Standardwerk
der Religionswissenschaft angesehen wird und viele Auflagen erlebte.
Am 31. Mai 1952 ernannte
Papst Pius XII. König zum Titularbischof von Livias und Koadiutor mit dem Recht
der Nachfolge des St. Pöltener Bischofs Michael Memelauer. Am 31. August 1952
erfolgte die Bischofsweihe im Dom zu St. Pölten durch Bischof Michael
Memelauer. Im Herbst desselben Jahres wurde er von den österreichischen
Bischöfen zum Referenten für Jugendfragen gewählt. 1956 erschien sein
"Religionswissenschaftliches Wörterbuch".
Am 10. Mai 1956 ernannte
Papst Pius XII. König zum Erzbischof von Wien, am 17. Juni erfolgte die
Inthronisation. König wählte als Motto eine Stelle aus dem Epheserbrief des
Apostels Paulus "Veritatem facientes in caritate" (Die Wahrheit in
Liebe tun). In das Kardinalskollegium wurde er am 15. Dezember 1958 von Papst
Johannes XXIII. aufgenommen.
Am 21. Februar 1959
wurde Kardinal König für kurze Zeit zum Militärvikar für Österreich ernannt.
Als Erzbischof von Wien war König Befürworter und Motor einer den Menschen
nachgehenden Seelsorge. Er selbst unternahm viele hunderte von Besuchen in
Pfarren, aber auch Betrieben und Schulklassen, um mit arbeitenden Menschen und
mit der Jugend in persönlichen Kontakt zu kommen.
1965 vertraute ihm Papst
Paul VI. die Leitung des neugegründeten vatikanischen Sekretariates für die
Nichtglaubenden an. In dieser Funktion nahm Dr. König auch regelmäßig am
"Vatikanischen Ministerrat", der Arbeitssitzung der Vorsitzenden der
Kurienorgane, teil.
Als spezifische Aufgabe
des Erzbischofs von Wien sah Kardinal König die Überwindung der Isolierung der
Kirche im kommunistischen Machtbereich durch Herstellung brüderlicher Kontakte
der Kirche in Österreich zu den Nachbarkirchen im Osten. Er selbst reiste als
erster "westlicher" Kardinal nach Osteuropa. Bei der ersten dieser
Reisen - der Fahrt zum Begräbnis des Zagreber Kardinals Stepinac - erlitt er am
13. Februar 1960 bei einem Autounfall schwere Verletzungen. Später unternahm
der Kardinal zahlreiche Besuche in fast allen Oststaaten, die stets der
Begegnung mit Bischöfen, Priestern und Gläubigen der Kirche dieser Länder
dienten.
Im Auftrag von Johannes
XXIII. fuhr er am 18. April 1963 erstmals in die amerikanische Gesandtschaft
nach Budapest, um mit dem dort im Asyl lebenden ungarischen Primas Mindszenty
zu sprechen. Diese Besuche wiederholten sich in den folgenden Jahren und
führten schließlich zur Ausreise Mindszentys. Von Anfang an bildeten
ökumenische Kontakte einen weiteren Schwerpunkt von Kardinal Königs Wirken.
Durch Besuche beim
Patriarchen Athenagoras von Konstantinopel, beim rumänischen Patriarchen in
Bukarest, beim koptischen Patriarchen in Kairo, beim serbischen Patriarchen und
zahlreichen anderen führenden Persönlichkeiten wurden entscheidende Kontakte
für den Dialog mit den orthodoxen Kirchen geknüpft. Eine besondere Funktion
übernahm dabei die von König 1964 gegründete Stiftung "Pro Oriente",
die vor allem durch ihre internationalen ökumenischen Symposien dem
theologischen Gespräch weitreichende Impulse zu geben vermochte. Großes
Interesse brachte Kardinal König - auch als Wissenschaftler - den
nichtchristlichen Religionen entgegen. 1964 leitete er im Rahmen des
Eucharistischen Weltkongresses in Bombay das große Religionsgespräch, an dem
Vertreter aller Weltreligionen teilnahmen. Auf vielfältige Weise trug Kardinal
König zum Dialog der katholischen Kirche mit Judentum und Islam bei.
Der langwierige Weg nach Europa
Kardinal Franz König
Der Weg nach dem neuen,
gemeinsamen Europa ist langwierig und schmerzlich. Dies verlangt einerseits vom
Westen des Kontinents ein besonderes Maß an Solidarität. Für Österreich
andererseits ist aber ein Prozeß der Bewußtwerdung im Gange, daß dieses Land in
Europa aufgrund seiner geographischen Lage, besonders seiner Geschichte des
ehemaligen Habsburgerreiches eine Verbindungsfunktion, eine Brückenfunktion
besonderer Art zur Kenntnis nehmen soll. Hier, an der ehemaligen Grenze zweier
Welten, sozusagen, - der Eiserne Vorhang war bis zur Wende gleichzeitig im
Osten und Südosten Österreichs die Staatsgrenze - ist man deutlicher konfrontiert
mit östlichen, das heißt, vor allem mit den slawischen Sprachen, mit den Folgen
des abendländischen Schismas von 1054, aus dem die orthodoxen Kirchen
hervorgegangen sind; hier ist die historische Begegnung zwischen Rom und Byzanz
noch immer sehr lebendig, wie es uns der Balkan der Serben und Kroaten vor
Augen führt. Denn das Christentum kam aus dem östlichen Byzanz nach Serbien und
aus dem lateinischen Rom nach Kroatien. Daher sind die Kroaten heute
römisch-katholisch und die serben seit dem Jahr 1054 orthodox. Daraus entstand
trotz des gleichen Glaubensbekenntnisses und der gleichen Sprache eine
Entfremdung, ein Gegensatz und eine tiefe Kluft. Und in Bosnien und in
Herzegowina hatte der Islam in der Vergangenheit eine Brückenfunktion zur
östlichen und westlichen Christenheit ausgeübt. Hier in Österreich kann man
also mehr als anderswo die Schwierigkeiten des historischen Konfliktes einer
östlich-westlichen Spannung erkennen und sich daher auch mehr als anderswo auf
die Suche nach immer neuen Wegen der Verständigung machen. Wer sollte mehr
Verständnis für diesen zweifellos schwierigen Prozeß haben können, als
Österreich, dessen Menschen durch die Last der Geschichte, aber auch durch eine
ähnliche Mentalität, ja, durch Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen immer
wieder veranlaßt waren, nicht nur über die Grenzen zu blicken, sondern sie auch
immer wieder zu überschreiten.
Über Einladung Papst Johannes XXIII. Überschritt ich zum ersten mal den
Eisernen Vorhang in Richtung Budapest, um den dort in der amerikanischen
Botschaft im Asyl befindlichen Kardinal Mindszenty zu besuchen. Noch vor Beginn
des Zweiten Vatikanischen Konzils fragte mich Papst Johannes XXIII., warum ich
Kardinal Mindszenty, den Primas der katholischen Kirche Ungarns, noch nicht besucht
hätte. Diese Frage wurde für mich Anlaß, um einen ersten Versuch zu
unternehmen, aus Wien hinaus den Eisernen Vorhang zu überschreiten, um
katholische Bischöfe, Diözesen und Pfarrgemeinden des Ostens aufzusuchen. Nach
Überwindung einiger diplomatischer Schwierigkeiten war dies damals auch
gelungen. So wurde mir in etwa bewußt, welcher Gegensatz besteht zwischen einem
östlichen und westlichen Europa. Und damit wurden mir folgende Zusammenhänge
allmählich deutlicher:
Die Geschichte
Zentraleuropas, durch Jahrhunderte die Geschichte des Habsburgerreiches, ist
noch immer eine Kraft, die Staat und Nationen in der Mitte Europas in einer
besonderen Weise verbindet. Was in der Zeit der Habsburgermonarchie in
Mitteleuropa aufgebaut wurde, besteht heute noch als Gefühl gegenseitiger
Verbundenheit über alle geschichtlichen Ereignisse hinweg. Das beinhaltet eine
besondere Aufgabe für Österreich. Ich weise damit auf einige Beispiele hin:
Mit dem Blick auf die
Zukunft Europas wird es für die junge Generation immer mehr eine Aufgabe sein,
sich für Geschichte und Sprachen des slawischen Ostens zu interessieren. In
Österreich soll es daher für junge Menschen ein Anliegen sein, nicht nur
westliche, sondern auch östliche (slawische) Sprachen zu lernen.
Westeuropa ist gewiß
nicht Europa, sondern nur ein Teil und kann weder durch Geld, noch durch
wirtschaftliche Dominanz allein den Weg Europas bestimmen. Der Wunsch und der
Wille der osteuropäischen Staatengruppe, genau genommen, ihr Recht, in die
europäische Union aufgenommen zu werden, ist für die Zukunft Europas von großer
Wichtigkeit. Wenn daher in Westeuropa die wirtschaftlichen Interessen allein
entscheiden und die Bedingungen für die Aufnahme vorschreiben, so kann das eine
tiefe Enttäuschung, ja, eine Abkehr Osteuropas von Europa fördern. Wer
persönlich den Osten kennt, sich mit dem Osten daher auch verbunden weiß, wer
um den guten Willen jener Menschen weiß, die nach dem Gang durch die
kommunistische Wüste ihren Staat und ihre Wirtschaft wieder aufbauen wollen, um
das sogenannte Europa-Niveau zu erreichen, der fühlt sich bedrückt durch den
Eindruck, daß der Weg nach Europa scheinbar in erster Linie vom westlichen
Europa abzuhängen scheint. Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit einer
gesicherten Wirtschaft als Grundlage einer sozialen Ordnung, scheint mir mehr
Großmut und Bereitschaft zu einer direkten und moralischen Unterstützung ein
Gebot der Stunde zu sein. Daher ist es angezeigt, nicht über die
"Osterweiterung" zu sprechen, sondern über die "Europäisierung"
des Kontinents.
Die christlichen Kirchen
können hier viel mithelfen, durch ihre lebendige grenzüberschreitende
Glaubensgemeinschaft. In Österreich haben wir ein praktisches Beispiel. Bereits
im Jahre 1964, also noch im zweigeteilten Europa, ergab sich durch die Gründung
der Stiftung "Pro Oriente" in Wien eine Möglichkeit, aus
mitteleuropäischer Sicht Brücken nach dem Osten zu bauen. Diese Wiener Stiftung
mit dem Hinweis auf den Namen der Stadt, die immer noch einen guten Klang in
Osteuropa hat, kann so genützt werden für das ökumenische Gespräch, für
ökumenische Begegnungen mit der Orthodoxie. - Unlängst hat Patriarch
Bartholomaios von Konstantinopel aufmerksam gemacht, daß durch "Pro
Oriente" ein "Dienst der Versöhnung" geleistet werde; der Patriarch
von Moskau und ganz Rußland, Alexij II., sprach von einer hundertfältigen
Frucht durch die Tätigkeit von "Pro Oriente". Wenn der Amerikaner S.
P. Huntington in seinem Buch "The Clah of Civilizations" (251,508)
von einer historischen Scheidelinie spricht, die seit Jahrhunderten die
christlichen Völker des Westens von den muslimischen und (!) orthodoxen Völkern
trennt, so hat die Stiftung "Pro Oriente" durch ihre ökumenische
Arbeit aufmerksam gemacht, daß durch die ökumenische Arbeit von "Pro
Oriente" Brücken für das größere Europa gebaut werden können.
Mit solchen Hinweisen wird es deutlich, daß für Österreich der weg nach Europa
über Mittel- oder Zentraleuropa geht. Denn hier, an den östlichen und
südöstlichen Grenzen Österreichs begegnen sich Christen verschiedener
Konfessionen und Sprachen, germanische, slawische, romanische, die für die
Geschichte Europas von besonderer Bedeutung waren und bleiben. As ist zugleich
ein kultureller Reichtum, der für das künftige Europa heute im westlichen Europa
nicht ausreichend gesehen, vielleicht auch nicht verstanden wird.
An der schwelle eines neuen Millenniums stellen wir daher fest: Für das
Verständnis des neuen Europas ist die Kenntnis der mitteleuropäischen
Geschichte, Kultur und Religionsgeschichte wesentlich.
Wie zur Zeit eines Benedikt, zur zeit der Völkerwanderung, haben wir heute die
Last und die Chance eines neuen Anfangs. Das Schicksal dieses neuen Europas aus
Ost und West mit dem Akzent auf der Brückenfunktion Mitteleuropas liegt in
unseren Händen; Österreich ist in besonderer Weise dafür mitverantwortlich.
Empfang in
der Russische orthodoxe Kathedrale zum Hl. Nikolaus in Wien
Offener Brief
Seiner
Heiligkeit Patriarch ALEKSIJ II,
Patriarch von Moskau und der Ganzen Rus',
an
die Bischöfe, den Klerus und die Gläubigen Russischer Orthodoxer Tradition in
West-Europa
Besuch S.E. des Metropoliten KYRILL von Smolensk und Kaliningrad
Vorsitzender des Aussenamtes des
Moskauer Patriarchates in WIEN
S.Heiligkeit Patriarch ALEKSIJ II.:
"Die WELT auf dem KREUZWEG"
zu den neuen globalen Herausforderungen an der Jahrtausendwende
S.E. Metropolit KYRILL
"Die UMSTAENDE einer NEUEN ZEIT"
zur Bedeutung christlicher Werte im sich vereinigenden Europa
"Im Zeichen des Milleniums"
!!! All-Orthodoxe Begegnung im Heiligen Land !!!
Bild, Bericht und Botschaft
- FEIERN und BESUCHE zu "100 Jahre Hl. NIKOLAUS KATHEDRALE zu
Wien"
- BEGRAEBNIS S.E.
Metropolit IRINEJ von WIEN und OESTERREICH
Empfang in der Russische orthodoxe Kathedrale zum Hl.
Nikolaus in Wien
Am 30. Oktober 2003
besuchten auf Einladung des Vertreters der Russisch-Orthodoxen Kirche bei der
EU, des Bischofs von Wien und Österreich, Hilarion, die Vertreter der
Christlichen Kirchen und Gemeinden die Kathedrale zum Hl. Nikolaus in Wien
(Jaurèsgasse 2).
Am Empfang nahmen teil: Seine Eminenz der Metropolit von Austria, Exarch von
Ungarn und Westeuropa Dr. Michail Staikos; in Vertretung des Pirmas von Ungarn,
Erzbischof DDr. Peter Erdö Prälat Dr. Eörs Csordas vom Pazmaneum in Wien; Frau
Oberin Professor Christine Gleixner vom Ökumenischen Rat der Kirchen
Österreichs; der Superintendent der Evangelischen Kirche AB Magister Werner
Horn; der Bischof der Altkatholischen Kirche Österreichs Bernhard Heitz; Hochw.
Prälat, der Abt des Stiftes Heiligenkreuz Gregor Henckel-Donnersmarck;
Kanonikus Patrick Curran von der Anglikanischen Kirche Österreichs; der
Superintendent der Methodistenkirche Österreichs Lothar Pöll; Frau Maria Anna
Mayr-Melnhof Mitglied des Kuratoriums von Pro Oriente; der Präsident von Pro
Oriente Dr. Johann Marte und andere Mitglieder von Pro Oriente; Vertreter der
Caritas Österreich; die Vertreter aller orthodoxen Kirchen in Österreich;
Vertreter der altorientalischen Kirchen; von der Österreichischen Gesellschaft
für Kirchenrecht: Ord.Univ.Prof. Dr. Richard Potz; Frau Dr. Brigitte Schinkele;
Dr. René Kuppe und andere.
Im Verlauf des Empfanges hielt Bischof Hilarion eine kurze Ansprache an die
Gäste, deren Text nachstehend angeführt ist.
Grußwort des Vertreters der Russischen Orthodoxen Kirche bei der EU, des
Bischofs Hilarion von Wien und Österreich, beim Empfang in der Kathedrale zum
hl. Nikolaus in Wien am 30. Oktober 2003
Eminenzen, Exzellenzen, verehrte Gäste!
Ich begrüße Sie herzlich in den Räumlichkeiten der Kathedrale zum hl. Nikolaus,
der Kathedralkirche der Diözese der Russischen Orthodoxen Kirche von Wien und
Österreich.
Wien ist die Hauptstadt eines Landes, in dem die überwältigende Mehrheit der
Gläubigen der Katholischen Kirche angehört. Dennoch war Österreich immer für
seine ökumenischen Traditionen berühmt; hier wirken auch die anderen
christlichen Gemeinden ungehindert und in enger Zusammenarbeit. Die Teilnahme
von hohen Vertretern der Katholiken, Orthodoxen und Protestanten am heutigen
Empfang ist der sichtbare Ausdruck dieser Einheit und der brüderlichen
Zusammenarbeit.
Die russische Orthodoxie ist auf österreichischem Boden schon mehr als 250
Jahre heimisch. Die ersten Priester aus Russland kamen in der Mitte des XVIII.
Jahrhunderts nach Wien; anfangs verrichteten sie ihren Dienst in
Räumlichkeiten, die der Russischen Botschaft gehörten. Gegen Ende des XIX.
Jahrhunderts wurde auf dem Territorium der Botschaft diese mächtige Kirche
gebaut, die bis heute eine Zierde der österreichischen Hauptstadt ist. Zurzeit
werden an der Kirche weitläufige Restaurationsarbeiten begonnen, deren Ziel
eine völlige Erneuerung der Kirche sowohl außen als auch innen ist.
Die Russische Orthodoxe Kirche ist nicht nur die Kirche Russlands: zu ihr
gehört die Mehrzahl der Gläubigen in der Ukraine, der Belarus, Moldovas, der
Baltischen Länder und der Staaten Mittelasiens. Deshalb haben wir unter unseren
Gläubigen Vertreter der verschiedensten Nationalitäten. Den Gottesdienst am
Sonntag besuchen 200 bis 300 Personen, an großen Feiertagen kommen fast 1000
Gläubige, und die Kirche kann alle, die sie besuchen wollen, nicht fassen. Die
Gottesdienste werden in kirchenslavischer und teilweise in deutscher Sprache gehalten.
Es gibt eine Sonntagsschule für Kinder und katechetische Gespräche für
Erwachsene.
Ich möchte Ihnen allen, liebe Gäste, bestätigen, dass unsere Kirche und unsere
Diözese zur aktiven Zusammenarbeit mit den christlichen Gemeinden Österreichs
bereit ist. Nur mit gemeinsamen Anstrengungen können wir den Anforderungen der
heutigen säkularen Gesellschaft widerstehen, in der eine sehr schnelle Abkehr
von den sittlichen und geistigen Idealen des Christentums vor sich geht.
Gestatten Sie mir, Sie alle, liebe Gäste, noch einmal in diesem Gotteshaus zu
begrüßen und Ihnen gute Gesundheit, ein langes Leben und die unerschöpfliche
Hilfe Gottes in Ihrer Arbeit zu wünschen.
Vorlesung des Metropoliten Kyrill von
Smolensk und Kaliningrad bei der Tagung über die Grundlagen der
Sozialkonzeption der Russischen Orthodoxen Kirche (Wien, Österreich, 10.9.03)
Die Jubiläums-Bischofssynode der Russischen Orthodoxen Kirche, die im Jahre
2000 stattgefunden hat, verabschiedete eine große Zahl von wichtigen
Beschlüssen und Dokumenten, wie es nie zuvor in den letzten Jahrzehnten der
Fall war. Unter ihnen nehmen die durch die Synode einstimmig beschlossenen
"Grundlagen der Sozialkonzeption der Russischen Orthodoxen Kirche"
eine besondere Stellung ein. Dieses Dokument kodifiziert die orthodoxe Sicht
auf eine Fülle von Aspekten der gegenseitigen Beziehungen von Kirche, Staat und
Gesellschaft, aber auch auf brennende Probleme der Gegenwart.
Seit Beginn der 80er Jahre wuchs in unserer Kirche das Bedürfnis, den Sinn des
zurückgelegten historischen Weges zu ergründen und eine Strategie für die
kirchliche Tätigkeit für die nächste Zukunft zu entwerfen. Außerdem hatten sich
viele Fragen angehäuft, auf die keine klare kirchliche Antwort gegeben worden
war, und auch hätten nicht alle in der Vergangenheit geeigneten Antworten auf
heute angewendet werden können. Es war eine echte pastorale Notwendigkeit
entstanden, für den Menschen der Gegenwart eine rechte Orientierung im
gesellschaftlichen und persönlichen Leben aufzuzeigen. Eine derartige Arbeit
konnte nur auf Grundlage einer seriösen Beurteilung der historischen Erfahrung,
der daraus gewonnenen Einsichten und einer Standortbestimmung der Kirche
hinsichtlich ihrer Beziehung zu den neuen Realitäten durchgeführt werden.
Im 20. Jahrhundert durchlebte die Russische Orthodoxe Kirche eine bisher
beispiellose Etappe ihrer Geschichte. Nach einer fast 1000jährigen
Unterstützung von Seiten des Staates und der Gesellschaft wurde unsere Kirche
im Jahre 1917 mit offener Feindschaft und einer aggressiven, auf die Ausmerzung
der Religion zielenden staatlichen Politik konfrontiert. Diese Ereignisse
stellten die akute Frage nach der Beziehung der Russischen Kirche zu den
verschiedenen politischen Systemen und Ideologien. Hatte es doch die Russische
Kirche bis zur Februarrevolution einzig und allein mit der Staatsform einer
Monarchie zu tun gehabt, welche die Orthodoxie zum Fundament der Sozialordnung
gemacht hatte.
Die besten Geister des damaligen Russland, unter ihnen auch viele Bischöfe,
Seelsorger und Theologen, verstanden, dass die Kirche eine gewisse Last der
sittlichen Verantwortung für die ausgebrochene Katastrophe trug. Die
revolutionären Ereignisse beschleunigten die Erarbeitung eines umfassenden
Planes für die Gesundung des kirchlichen Lebens, der auf dem Allrussischen
Landeskonzil 1917-1918 erörtert wurde. Aber den Konzilsbeschlüssen war es auf
Grund der einsetzenden bolschewistischen Verfolgungen nicht beschieden, zur
Gänze umgesetzt und entwickelt zu werden. Unter diesen nicht einfachen Bedingungen
versuchte das kirchliche Bewusstsein intensiv, seine Beziehung zur neuen Macht
und ihrer Tätigkeit zu klären. Die ersten Schritte in dieser Richtung unternahm
noch der heilige Patriarch Tichon (Belavin), der sich in seinen letzten
Lebensjahren bemühte, der Kirche im sowjetischen Staat eine legale Stellung zu
gewährleisten. Dieses Unterfangen setzte Metropolit, später Patriarch Sergij
(Stragorodskij) fort.
Einige Menschen verstehen bis heute das Verhalten der Kirche in der
sowjetischen Zeit nicht richtig, indem sie es als Versöhnung mit dem
offiziellen Atheismus, ja sogar als Komplizenschaft mit ihm betrachten. Ja, die
sowjetische Regierung verlangte wie jedes andere Regime Loyalität gegenüber
ihrem politischen System, d.h. den Verzicht auf jedwede Tätigkeit, die ihren
Sturz zum Ziel hatte. Und in diesem Sinn eben anerkannte die Kirche die
Sowjetmacht, und in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges rief sie ihre
Töchter und Söhne zur Verteidigung des Vaterlandes und zum Kampf gegen den
Nazismus auf. Dabei war beiden Seiten die Unvereinbarkeit der
totalitär-kommunistischen Ideologie und des orthodoxen Glaubens offensichtlich.
Eben aus diesem Grunde war es der Kirche verboten, die Mauern des Gotteshauses
zu verlassen und auf dem Gebiet der Bildung, Wohltätigkeit, eines weiten
Verlagswesens und in der Öffentlichkeit überhaupt aktiv zu sein. Einem
aufmerksamen Erforscher der Sowjetzeit in der Geschichte der Russischen Kirche
werden Fakten nicht verborgen bleiben, die davon Zeugnis ablegen, dass unsere Bischöfe
und Seelsorger sich mit allen Kräften bemühten, das Zeugnis der Kirche in der
sowjetischen Gesellschaft zu erhalten und auszuweiten. So haben sie Kirchen und
Klöster bei Schließungsversuchen verteidigt, wie das der Metropolit von Tallin
und Estland, der heutige Patriarch von Moskau und der ganzen Rus' Seine
Heiligkeit Aleksij (Rüdiger) gemacht hat. Oder sie haben die internationalen
Kontakte der Kirche ausgedehnt und ihr somit die Unterstützung der
Weltöffentlichkeit gewährleistet, wie das der Metropolit von Leningrad und
Novgorod Nikodim (Rotov) gemacht hat. Mehr noch, die Kirche hat ihre
Unversöhnlichkeit mit der Ideologie des Atheismus durch eine Schar von
Märtyrern und Bekennern bezeugt, die trotz Nötigung und physischer Gewalt sich
von Christus nicht lossagten und Kirchen und Heiligtümer nicht der Entehrung
anheim geben wollten. Ich meine, nicht zufällig wurden die "Grundlagen der
Sozialkonzeption der Russchen Orthodoxen Kirche" eben auf jener
Jubiläumssynode beschlossen, die auch mehr als 1000 russische Neumärtyrer und
Bekenner kanonisierte. Ihr Zeugnis hat in diesem Dokument seinen Niederschlag
gefunden.
Am Ende der 80er Jahre trat unsere Kirche in eine neue Etappe ihrer Geschichte.
Es taten sich vor ihr wiederum große Möglichkeiten zur Mission und zum Dienst
unter den Menschen der Länder der GUS und des Baltikums auf. Aber die Kirche
kehrte jetzt nicht in dieselbe Gesellschaft zurück, aus der sie nach der
Revolution herausgerissen worden war. Die Psychologie der Menschen hatte sich
verändert, verändert waren die gesellschaftlichen Werte und die äußere Umwelt,
in der die stürmische Entwicklung der neuen Technologien ihren Niederschlag
gefunden hatte. All das erforderte auch ein neues Wort. Denn in der
vorrevolutionären Literatur und umso mehr in den Werken der Heiligen Väter war
nichts zu finden z. Bsp. über die ökonomische Globalisierung, über
"humanitäre Intervention", über Klonen oder Geschlechtsumwandlung.
Die Kirche stand real vor der Aufgabe, dem orthodoxen Christen eine Antwort zu
geben, wie man in der heutigen widersprüchlichen und dynamisch sich
verändernden Welt ein solcher bleiben kann.
Mit der Zunahme der Fragen, welche die verschiedenen Seiten des Lebens des
heutigen Menschen betreffen, wuchs jedoch auch die Zahl der Antworten. Viele
Priester und Laien ließen mitunter einander widersprechende Äußerungen und
Handlungen zu.
Gleichzeitig existierte eine große Zahl von Erklärungen der Bischofssynoden,
des Hochheiligen Patriarchen und des Heiligen Synods, die verschiedene
gesellschaftlich bedeutsame Themen betrafen, wie die Beziehungen zwischen
Kirche und Staat, Konfliktsituationen in Russland und in der Welt, ökonomische
und soziale Probleme, die Haltung zum Krieg und zum Wehrdienst, verschiedene
Aspekte der Bioethik, die Entwicklung eines nationalen Rechts, globale
Administration usw. Besonders viele solcher Erklärungen erfolgten am Ende der
80er Jahre und in den 90er Jahren. Die Position des Moskauer Patriarchats
angesichts der gesellschaftlichen Fragen war jedoch in Dutzenden von Dokumenten
verstreut, von denen viele keine breite Bekanntheit erlangt hatten.
Mit einem Wort, unsere Kirche war mit der Notwendigkeit der Kodifizierung oder
Erarbeitung ihrer Position hinsichtlich vieler aktueller Fragen konfrontiert.
Dazu musste die richtige Methode für die Formulierung der kirchlichen Lehre
ausgewählt werden, die sich auf die Heilige Schrift und die Heilige Tradition
der Orthodoxen Kirche unter Berücksichtigung der russischen theologischen
Tradition stützte.
Von allem Anfang an war es klar, dass ein derart wichtiges Dokument nur durch
das konziliare Denken der Kirche beschlossen werden konnte. Daher begann die
Ausarbeitung des Textes der "Grundlagen der Sozialkonzeption der
Russischen Orthodoxen Kirche" mit dem Beschluss der Bischofssynode des
Jahres 1994 über die Schaffung einer entsprechenden Arbeitsgruppe, die in der
Folge aus Bischöfen, Klerikern, Dozenten der kirchlichen Bildungsanstalten und
Mitarbeitern der Synodalen Abteilungen bestand. Nach der Fertigstellung des
Entwurfes und seiner Erörterung mit Vertretern verschiedener kirchlicher,
staatlicher und gesellschaftlicher Institutionen wurde der Text der Grundlagen
der Sozialkonzeption auf der Jubiläums-Bischofsynode approbiert.
Die "Grundlagen der Sozialkonzeption der Russischen Orthodoxen
Kirche" sind ein umfangreiches und umfassendes Dokument, das Duzende von
Themen behandelt. Dazu genügt es bereits, seine Abschnitte aufzuzählen:
"Theologische Grundpositionen", "Kirche und Nation",
"Kirche und Staat", "Christliche Ethik und weltliches
Recht", "Kirche und Politik", "Die Arbeit und ihre
Früchte", "Eigentum", "Krieg und Frieden",
"Verbrechen, Sühne, Wiedergutmachung", "Fragen der persönlichen,
familiären und gesellschaftlichen Sittlichkeit", "Die Gesundheit der
Person und des Volkes", "Fragen der Bioethik", "Die Kirche
und Fragen der Ökologie", "Weltliche Wissenschaft, Kultur und
Bildung", "Die Kirche und die weltlichen Massenmedien" und
"Internationale Beziehungen. Probleme der Globalisierung und des
Säkularismus".
In vielen Fällen formuliert das Dokument konkrete Regeln für den Episkopat, den
Klerus und die Laien - z. Bsp. bezüglich der pastoralen Praxis bei Scheidungen
und Abtreibungen, der Mechanismen der gegenseitigen Beziehungen mit
verschiedenen Ebenen und Branchen der Staatsmacht und konkreter
Verfahrensweisen der Konfliktlösung mit der Staatsmacht und mit
Masseninformationsmitteln, darunter auch durch die Vertretung der Interessen
der Kirche vor Gericht.
Im Rahmen der heutigen Vorlesung ist es unmöglich, alle Aussagen des Dokuments
auch nur kurz darzulegen. Wir werden jedoch versuchen, unser Augenmerk auf
einige ausgewählte Stellen zu richten, die für die westlichen Christen nicht
uninteressant erscheinen.
Nicht wenige Diskussionen lösen die Probleme der Beziehungen zwischen Kirche,
Person und Staat aus. Im Abschnitt "Kirche und Staat" heißt es:
"Als unerlässlicher Bestandteil des Lebens in der gefallenen Welt, in der
Person und Gesellschaft des Schutzes gegen die gefährlichen Erscheinungsformen
der Sünde bedürfen, ist der Staat von Gott gesegnet.... Die Heilige Schrift
ruft die Machthabenden auf, die staatliche Gewalt zur Abwehr des Bösen und zur
Unterstützung des Guten zu gebrauchen, worin der moralische Sinn der Existenz
des Staates gesehen wird (Röm 13,3-4)."
Die Kirche schreibt ihren Kindern vor, sich der staatlichen Gewalt unabhängig
von den Überzeugungen und der Konfession ihrer Träger nicht bloß unterzuordnen,
sondern auch für sie zu beten, "damit wir in aller Frömmigkeit und
Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können" (1 Tim 2,2). Dabei ist
es aber auch sehr wichtig, die Grenzen der Kompetenz der staatlichen Gewalt
festzulegen, daher ist im Dokument geschrieben: "Gleichzeitig dürfen die
Christen die Staatsgewalt jedoch nicht verabsolutieren und die Grenzen ihres
rein irdischen, zeitlichen und vergänglichen Sinns ignorieren, der durch das
Vorhandensein der Sünde in der Welt und die Notwendigkeit, ihr Einhalt zu
gebieten, bedingt ist." Der Staat darf sich selbst keinesfalls in eine
sich selbst genügende Institution verwandeln. Wir wissen, dass es in der
Geschichte nicht nur einmal eine solche Tendenz gegeben hat, wir wissen auch,
zu welch gefährlichen Folgen sie führen kann.
Wir anerkennen das Prinzip der gegenseitigen Nichteinmischung der Kirche und
des Staates in die Angelegenheiten des jeweils anderen, aber wir können mit
einem Verständnis des weltlichen Charakters der Staates nicht einverstanden
sein, bei dem die "radikale Verdrängung der Religion aus allen Bereichen
des öffentlichen Lebens", der "Ausschluss der religiösen
Vereinigungen bei der Bewältigung öffentlich relevanter Aufgaben" und der
"Entzug ihres Rechtes auf Bewertung der Tätigkeit der Staatsgewalt"
als Norm gelten.
Die Lage der Kirche im säkularen Staat wird im Dokument in folgender Weise dargelegt:
"Die Kirche darf nicht Funktionen an sich ziehen, die zum
Zuständigkeitsbereich des Staates gehören, wie etwa: gewaltsamen Widerstand
gegen die Sünde, Inanspruchnahme staatlicher Vollmachten, Übernahme von
Funktionen der Staatsgewalt, die Zwang oder Einschränkung beinhalten.
Allerdings darf die Kirche die Staatsmacht bitten oder gar auffordern, in
bestimmten Fällen ihre Macht einzusetzen; das Recht zur Entscheidung in dieser
Frage bleibt jedoch dem Staat vorbehalten." Seinerseits jedoch "darf
sich der Staat nicht in das Leben der Kirche, in ihre Verwaltung, ihren
Gottesdienst, ihre geistliche Praxis usf. einmischen, wie auch grundsätzlich in
die Tätigkeit der kanonischen kirchlichen Einrichtungen" - mit Ausnahme
natürlich jener Seiten ihrer Tätigkeit, die den Status einer juristischen
Person voraussetzen, die bürgerliche Rechtsbeziehungen aufnimmt. Die Grenzen
der Loyalität der Kirche gegenüber der Staatsgewalt sind durch das göttliche
Gebot festgelegt, die Wahrheit Christi zu verkünden und das Werk des Heiles der
Menschen unter beliebigen Bedingungen, in beliebigen Umständen zu erfüllen. Wie
lesen im Dokument: " Wenn die staatliche Macht die orthodoxen Gläubigen
zur Abkehr von Christus und Seiner Kirche sowie zu sündhaften, der Seele
abträglichen Taten nötigt, so ist die Kirche gehalten, dem Staat den Gehorsam
zu verweigern.... Sollte die Unterordnung unter staatliche Gesetze und
Verfügungen der Staatsmacht von Seiten der Fülle der Kirche unmöglich sein, ist
die Kirchenleitung nach der erforderlichen Prüfung der Frage berechtigt,
folgende Maßnahmen zu ergreifen: Aufnahme eines direkten Dialogs mit der
Staatsgewalt über das aufgekommene Problem, Aufruf an das Volk, die Mechanismen
der Volksherrschaft zur Änderung der Gesetzgebung sowie zur Revision der Entscheidungen
der Staatsgewalt anzuwenden, Appell an die internationalen Institutionen sowie
die internationale öffentliche Meinung, Appell an ihre Kinder, gewaltlosen
zivilen Widerstand zu leisten."
Die Kirche muss den Staat auf die Unzulässigkeit der Verbreitung von
Überzeugungen und Handlungen hinweisen, die zur Errichtung einer allseitigen
Kontrolle des Lebens der Person, ihrer Überzeugungen und Beziehungen zu anderen
Menschen, zur Zerstörung der persönlichen, familiären oder gesellschaftlichen
Sittlichkeit, zur Beleidigung religiöser Gefühle und zur Schädigung der
Eigenständigkeit des Volkes oder zur Bedrohung des heiligen Geschenkes des
Lebens führen. Im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen der Kirche und den
politischen Kräften erhebt sich die wichtige Frage der Prinzipien der
Gestaltung der Politik in den verschiedenen Sphären der menschlichen Tätigkeit.
Diese Frage hat im Abschnitt "Kirche und Politik" ihren Niederschlag
gefunden, wo darauf hingewiesen wird, dass der Aufruf zu Frieden und Zusammenarbeit
von Menschen mit verschiedenen politischen Anschauungen eine Aufgabe der Kirche
"im Angesicht der politischen Meinungsverschiedenheiten, Widersprüche und
Kämpfe" bleibt. Die Kirche "duldet auch verschiedene politische
Überzeugungen in der Mitte des Episkopats, des Klerus sowie der Laien, mit
Ausnahme solcher, die offensichtlich zu Taten führen, die der orthodoxen
Glaubenslehre und den moralischen Normen der kirchlichen Überlieferung
widersprechen." Dabei ist "die Teilnahme der Kirchenleitung und der
Geistlichen, folglich auch der Fülle der Kirche, an der Tätigkeit politischer
Organisationen, an Wahlaktionen wie etwa öffentlicher Unterstützung an Wahlen
beteiligter politischer Gruppierungen oder einzelner Kandidaten an
Wahlkampfwerbung usw. untersagt".
Das bedeutet jedoch nicht den Verzicht der Kirche auf "öffentliche
Stellungnahmen zu gesellschaftlich bedeutsamen Fragen und auf Vertretung ihrer
Position vor den Staatsorganen des jeweiligen Landes auf der jeweiligen Ebene.
Diese Stellungnahmen werden ausschließlich durch die kirchlichen Konzilien, die
Kirchenleitung sowie die von ihnen bevollmächtigten Personen vorgebracht. Das
Recht auf Äußerung solcher Positionen kann nicht an staatliche Organe, an
politische oder auch andere weltliche Organisationen delegiert werden."
Mit großer Aufmerksamkeit verfolgt die Kirche die gegenwärtige Gründung
orthodoxer Parteien und gesellschaftlich-politischer Bewegungen. Es ist eine
unzutreffende Auffassung, dass die kirchliche Hierarchie derartige Initiativen
unterdrücken müsse. Denn die Kinder der Kirche sind von Geburt an mit der
Freiheit der Wahl und der Äußerung ihrer Überzeugungen und ihrer Realisierung
im Rahmen gesellschaftlicher Tätigkeit ausgestattet.
Die Teilnahme orthodoxer Laien an der Arbeit der Organe der Legislative,
Exekutive und Judikatur und politischer Organisationen ist nicht nur nicht
untersagt, sondern ist sogar eine Form der Mission der Kirche in der
Gesellschaft, "wenn sie im .Einklang mit der Glaubenslehre der Kirche,
ihren moralischen Normen und ihrer offiziellen Position in gesellschaftlichen
Fragen geschieht". Die Laien sind in Erfüllung ihrer Bürgerpflicht
berechtigt und berufen, an politischen Prozessen teilzunehmen und an beliebigen
moralisch einwandfreien Aktionen des Staates mitzuwirken. Gleichzeitig können
die Gläubigen, die individuell oder im Rahmen verschiedener Organisationen an
staatlicher oder politischer Tätigkeit teilnehmen, das nur unter der Bedingung
tun, dass sie ihre politische Arbeit nicht mit der Position der Fülle der
Kirche oder irgendwelcher kirchlicher Einrichtungen identifizieren, als würden
sie in ihrem Namen auftreten. In den Grundlagen der Sozialkonzeption wird die
Einschränkung gemacht, dass "die höchste kirchliche Gewalt der politischen
Betätigung der Laien keinen speziellen Segen erteilt". Dennoch werden die
orthodoxen politischen Laienorganisationen, die sich bemühen, ihre politische
und staatliche Tätigkeit auf Grundlage der Prinzipien der christlichen
Spiritualität und Moral zu verwirklichen, "aufgerufen, die Kirchenleitung
zu Rate zu ziehen und ihre Aktivitäten im Bereich der Realisierung kirchlicher
Positionen bezüglich gesellschaftlicher Fragen mit ihr abzustimmen". Wenn
jedoch Organisationen, an deren Tätigkeit orthodoxe Laien teilnehmen, oder einzelne
orthodoxe Politiker und im staatlichen Bereich Tätige mit der allgemein
kirchlichen Position in gesellschaftlichen Fragen wesentlich differieren oder
sich der Realisierung einer solchen Position sogar widersetzen, veröffentlicht
die Kirchenleitung eine entsprechende Erklärung zur Vermeidung von
Missverständnissen zwischen den Gläubigen und breiten Gesellschaftsschichten.
Im Abschnitt "Eigentum" sagte sich die Russische Orthodoxe Kirche
entschieden von ihr aufgezwungenen Diskussionen über "mehr oder weniger
christliche" Eigentumsformen los, unter denen verschiedene weltliche
Kräfte bald die private, bald die kollektive und bald die gesellschaftliche
Eigentumsform verstehen. Gemäß den Grundlagen der Sozialkonzeption
"erkennt die Kirche die Existenz zahlreicher Eigentumsformen an. Die
staatliche, öffentliche, körperschaftliche, private und gemischte Eigentumsform
sind in den einzelnen Ländern auf unterschiedliche Art und Weise im Verlauf der
historischen Entwicklung verankert worden. Aus Sicht der Kirche ist keine
dieser Formen zu bevorzugen. Jede von ihnen kann ebenso sündhaften
Erscheinungen wie Diebstahl, Habgier und ungerechter Verteilung der Früchte der
Arbeit zugrunde liegen wie auch als Voraussetzung einer würdigen, moralisch
begründeten Nutzung der materiellen Güter dienen."
In der Auseinandersetzung mit dem heutigen Feminismus legt das Dokument die
orthodoxe Position zum Problem der sozialen Rolle der Geschlechter und ihrer
Gleichberechtigung dar (Abschnitt "Fragen der persönlichen, familiären und
gesellschaftlichen Sittlichkeit" ). So heißt es in den Grundlagen der
Sozialkonzeption: "Während die Kirche die gesellschaftliche Rolle der Frau
würdigt und ihre politische, kulturelle und soziale Gleichstellung mit den
Männern begrüßt, wendet sie sich zugleich auch gegen Tendenzen der Abwertung
der Rolle der Frau als Gattin und Mutter. Die fundamentale Gleichheit der Würde
der Geschlechter hebt die natürlichen Unterschiede zwischen ihnen nicht auf und
beinhaltet nicht die Gleichheit der Berufung in Familie und Gesellschaft...
Die Vertreter gewisser gesellschaftlicher Strömungen neigen dazu, der Ehe sowie
dem Institut der Familie die gebührende Wertschätzung abzusprechen oder diese
gar vollständig zu leugnen, indem sie der gesellschaftlich bedeutsamen Arbeit
der Frau, einschließlich solcher Arbeiten, die mit der weiblichen Natur kaum
oder gar nicht vereinbar sind (z.Bsp. einige schwere körperlichen Arbeiten) den
Vorrang einräumen. Nicht selten wird einer künstlichen Angleichung der
Beteiligung von Frauen und Männern an jeden Bereich menschlicher Tätigkeit das
Wort geredet. Die Kirche sieht die Bestimmung der Frau weder in der
unreflektierten Nachahmung des Mannes noch im Wetteifer mit ihm, sondern in der
Entfaltung aller ihr von Gott gegebenen Fähigkeiten... Das Streben danach, die
natürlichen Unterschiede im gesellschaftlichen Bereich nicht gelten zu lassen
bzw. auf ein Minimum zu reduzieren, ist dem kirchlichen Verständnis
fremd."
Speziell muss man den Fragenbereich behandeln, den man mit dem Begriff
"Bioethik" zusammenfasst. Diese Probleme sind die schwierigsten für
die theologische Interpretation. Denn neue biomedizinische Technologien rufen
bisweilen ethische und rechtliche Kollisionen hervor, an die man zu Zeiten der
Ökumenischen Konzilien nicht einmal denken konnte.
Als Antwort auf die Herausforderung unserer Zeit formulierte die Russische
Orthodoxe Kirche in den Grundlagen der Sozialkonzeption (im Abschnitt
"Fragen der Bioethik" ) eine umfassende, durchdachte und theologisch
fundierte Position zu einer ganzen Reihe von Fragen, die heute eine immer
steigende Aufmerksamkeit der Gesellschaft erregen; dabei stützte sich die
Russische Orthodoxe Kirche kreativ auf die für uns heiligen Normen der
Tradition und wandte sie auf die heutige Realität an.
Im Hinblick auf Probleme wie Abtreibung und Homosexualität war es bloß
erforderlich, die unveränderliche Lehre der Kirche zu bezeugen, die in der
Tradition ihren Ausdruck gefunden hat. Im Abschnitt "Fragen der
Bioethik" wird die Abtreibung verurteilt, es wird über die Sündhaftigkeit
homosexueller Geschlechtsbeziehungen gesprochen, und es ist die Überzeugung
ausgedrückt, dass "Personen, die eine homosexuelle Lebensführung
propagieren, keinerlei Berechtigung erhalten, sich auf den Gebieten der
Bildung, der Erziehung und sonstiger Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
beruflich zu betätigen." Demgegenüber mussten viele andere, völlig neue
Herausforderungen, die sich durch die stürmische Entwicklung der
biomedizinischen Technologien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
gestellt hatten, im Lichte jener Vorstellungen vom menschlichen Leben und der
Würde der menschlichen Person, die in der Göttlichen Offenbarung verwurzelt
sind, neu beacht werden.
Im Besonderen wurden die moralischen Aspekte der Anwendung neuer Reproduktionstechnologien
einschließlich der künstlichen und extrakorporalen Befruchtung, die Spendung
von Geschlechtszellen und die Leihmutterschaft beurteilt. Ein großer Teil davon
(mit Ausnahme der künstlichen Befruchtung unter Verwendung von Samenzellen des
Mannes) kann von der Kirche nicht gutgeheißen werden, die ja berufen ist, die
Würde der Person und die Integrität der ehelichen Beziehungen zu verteidigen.
Es wurden sowohl die positiven wie auch die negativen, für das Individuum und
die Gesellschaft gefährlichen Seiten der Entwicklung der gen-medizinischen
Methoden der Diagnostik und Behandlung, der genetischen Identifikation und der
pränatalen Diagnostik geprüft. Die grundlegenden Aussagen sind folgende:
"Die Kirche begrüßt die Bemühungen der Ärzte um eine Überwindung der
Erbkrankheiten. Zugleich darf das Ziel eines genetischen Eingriffs jedoch nicht
in der künstlichen ,Vervollkommnung' des Menschengeschlechts oder in einer
Änderung des Ratschlusses Gottes über den Menschen liegen... Deshalb dürfen die
genetische Identifikation sowie die genetische Testierung nur in
Übereinstimmung mit der Achtung der Freiheit der Person durchgeführt werden...
Die pränatale Diagnostik gilt als moralisch gerechtfertigt, wenn sie auf die
Heilung der entdeckten Krankheiten in möglichst frühen Stadien oder auf die
Vorbereitung der Eltern auf eine situationsgerechte Pflege des kranken Kindes
ausgerichtet ist. Das Recht auf Leben, Liebe und Fürsorge kommt jedem Menschen
zu, unabhängig von der Art der Erkrankung".
Auch auf das gefahrvolle Unterfangen des Klonens von menschlichen Wesen wird
eine kirchliche Antwort gegeben. Diese Idee ist "zweifellos eine Anmaßung
gegenüber der Natur des Menschen und seiner ihm eingeschriebenen
Gottebenbildlichkeit, deren unveräußerliche Bestandteile Freiheit und
Einzigartigkeit der Person sind". In Zusammenhang mit der stets steigenden
Anwendung der Transplantation von Geweben und Organen des Menschen werden vom
Standpunkt der Kirche aus wichtige Bedingungen für die moralische Zulässigkeit
solcher Eingriffe genannt: das freiwillige, zu Lebzeiten ausgedrückte
Einverständnis des Spenders und die Unzulässigkeit der Verkürzung des Lebens
eines Menschen um der Verlängerung des Lebens eines anderen willen. Unbedingt
abzulehnen ist die sogenannte Fötaltherapie, d.h. die Verwendung von Geweben
und Organen von abgetriebenen menschlichen Föten. Auch die Fragen der heutigen
Reanimatologie und Sterbehilfe wurden geprüft. Dabei wurde die eindeutige
Position der Kirche hinsichtlich der Unzulässigkeit der sogenannten Euthanasie
formuliert, d.h. der Tötung hoffnungslos Kranker selbst auf ihren Wunsch hin.
Im Zusammenhang mit der Zunahme von Eingriffen zur Geschlechtsumwandlung wird
gesagt, dass die Kirche eine tatsächlich künstlich geänderte
Geschlechtszugehörigkeit nicht anerkennen kann. Im Dokument heißt es:
"Wenn die ,Geschlechtsumwandlung' einer Person vor ihrer Taufe vollzogen
worden ist, so darf sie - jedem anderen Sünder gleich - zur Taufe zugelassen
werden, jedoch wird sie von der Kirche als ihrem ursprünglich angeborenen
Geschlecht zugehörig getauft. Die Priesterweihe sowie die kirchliche Trauung
bleiben diesem Menschen verwehrt."
Ich möchte unsere Aufmerksamkeit noch auf die Probleme der Globalisierung
lenken, die einen immer wichtigeren Einfluss auf unser Leben ausübt. Der
Abschnitt "Internationale Beziehungen. Probleme der Globalisierung und des
Säkularismus" behandelt einen ganzen Komplex von sehr wichtigen weltweiten
Problemen. Vor allem wird darauf hingewiesen, dass sich die christliche Ethik
nicht nur auf die Sphäre des persönlichen Lebens des Menschen erstreckt:
"Das christliche Ideal des Verhaltens der Völker und Regierungen im
Bereich der internationalen Beziehungen ist in der ,Goldenen Regel' enthalten:
,Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!' (Mt
7,12)."
Umfassend wird der Prozess der ökonomischen, politischen, Kultur- und
Informationsglobalisierung geprüft. Als Basis für eine allgemein kirchliche
Position in dieser Frage wird die Zusammenarbeit der Kirche mit den internationalen
Organisationen (UN, EU, Europarat u.a.) ausgebaut. Einerseits muss man
anerkennen, dass es sich dabei um einen unvermeidbaren Prozess handelt, der mit
der Entwicklung des Marktes, der Informationstechnologien und
Kommunikationsmittel verbunden ist. Andererseits ist die Kirche berufen, in
dieser neuen Situation die Prinzipien einer ehrlichen, gerechten, einander
achtenden und gleichberechtigten Zusammenarbeit zu verteidigen. Es ist
unzulässig, dass durch die Globalisierung eine beschränkte Zahl von Menschen
Weltmacht und Reichtum in ihren Händen konzentrieren. Es ist auch unzulässig,
dass Völker, zu denen fast drei Viertel der Weltbevölkerung gehören, an den
Rand der Weltzivilisation gedrängt werden.
Man muss besonders den Protest der Kirche gegen die "geistige und
kulturelle Expansion und die verhängnisvolle totale Vereinheitlichung"
hervorheben. Wir fordern eine Weltordnung, "die auf den Prinzipien der
Gerechtigkeit und der Gleichheit der Menschen vor Gott aufgebaut ist sowie die
Unterwerfung ihres Willens unter nationale oder globale Zentren unterbindet,
die politischen, wirtschaftlichen und informationellen Einfluss haben".
Es scheint vielleicht jemandem, dass Säkularisierung, Globalisierung,
internationale Politik und Politik nicht "unsere Sache" seien und
dass die Kirche sich in solche Prozesse nicht einmischen solle, um ihre
"Jenseitigkeit" zu bewahren. Aber gerade die Kirche ist für das
Schicksal der ganzen Menschheit verantwortlich, gerade ihre Stimme muss als
prophetische Stimme der Wahrheit Gottes ertönen, sonst erweist sie sich ihrer
Berufung als untreu.
Daher hat die im letzten Absatz dieses Abschnitts ausgesprochene Beurteilung
eine prinzipielle Bedeutung: "Das gegenwärtige internationale Rechtssystem
beruht auf dem Vorrang der Interessen des irdischen Lebens des Menschen und der
menschlichen Gemeinschaften vor den religiösen Werten (insbesondere in solchen
Fällen, in denen erstere mit letzteren in Konflikt geraten). Diese
Vorrangstellung ist in der nationalen Gesetzgebung vieler Staaten verankert...
Eine Anzahl einflussreicher öffentlicher Mechanismen bedient sich allerdings
dieses Prinzips in offener Konfrontation mit dem Glauben und der Kirche mit dem
Ziel, sie aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Diese Erscheinungen
schaffen das allgemeine Bild der Säkularisierung des Staats- und
Gesellschaftslebens. Auch wenn die Kirche der weltanschaulichen Entscheidung
nichtreligiöser Menschen sowie ihrem Recht auf Mitgestaltung der
gesellschaftlichen Prozesse Achtung zollt, ist sie zugleich nicht in der Lage,
eine Weltordnung gutzuheißen, die ihren Ausgang bei der durch die Sünde
verdorbenen menschlichen Person nimmt. Namentlich aus diesem Grund richtet die
Kirche - unter Beibehaltung der Offenheit zur Zusammenarbeit mit Menschen
nichtreligiöser Überzeugung - ihre Bemühungen darauf, die christlichen Werte im
Prozess der Entscheidungsfindung hinsichtlich der wichtigsten öffentlichen
Angelegenheiten sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene
geltend zu machen. Sie erstrebt die Anerkennung der Legitimität der religiösen
Weltanschauung als Basis gesellschaftlich relevanter Handlungen (einschließlich
solcher, die durch den Staat vorgenommen werden) sowie die Anerkennung als
eines wesentlichen Faktors, der auf die Entwicklung (Veränderung) des
Völkerrechts und der Tätigkeit internationaler Organisationen Einfluss
nimmt."
Dank der im Dokument angesprochenen aktuellen Probleme wurde ihm nicht nur in
Russland Interesse entgegengebracht, sondern auch im Ausland, und zwar nicht
nur in religiösen Kreisen, sondern auch in der weltlichen Gesellschaft. Wir
erörterten das vorliegende Dokument in verschiedenen Diözesen unserer Kirche,
im Parlament, bei öffentlichen Lesungen in verschiedenen Städten Russlands und
anderer Länder der GUS. Wir hatten zahlreiche Möglichkeiten, einzelne Aussagen
des Dokuments in den Massenmedien, bei Tagungen und persönlichen Begegnungen
mit religiösen, politischen und gesellschaftlichen Persönlichkeiten bekannt zu
machen und zu erklären.
Mit großer Genugtuung erfuhren wir in der Russischen Orthodoxen Kirche, dass
das Dokument auch unter Christen anderer Konfessionen reges Interesse
hervorrief. Das Dokument wurde in theologischen Gesprächen mit der
Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands und der Evangelischen Kirche in
Deutschland, im Rahmen des Weltrates der Kirchen und der Konferenz Europäischer
Kirchen und auf einer Tagung erörtert, die durch die Konrad-Adenauer Stiftung
in Deutschland veranstaltet wurde.
Welches Ergebnis haben wir durch den Beschluss dieses Dokuments erreicht?
Welchen Beitrag leistet es für das gegenwärtige Leben der Russischen Orthodoxen
Kirche? Vor allem kann jetzt die kirchliche Hierarchie auf allen Ebenen auf dem
Fundament eines konzeptuellen Zuganges zahlreiche Einzelfragen klären. Das Dokument
konstatiert eine Reihe konkreter Normen und Prinzipien und wird zu einer
verbindlichen praktischen Handreichung für Bischöfe, Priester und Laien. Das
erlaubt den Gliedern der Kirche, eine tatsächlich einheitliche und durchdachte
Position im Dialog mit der Staatsmacht und der Gesellschaft einzunehmen. Und
den "Außenstehenden", d.h. der säkularen Gesellschaft, gibt das
Dokument der Synode eine klare Vorstellung davon, was die Meinung der Kirche in
den gewichtigen Problemen der Gegenwart ist. Nach Maßgabe der Veränderung des
staatlichen und gesellschaftlichen Lebens, nach Maßgabe des Erscheinens neuer
Probleme und Herausforderungen, die eine Antwort der Kirche erfordern, wird
sich die Soziallehre unserer Kirche unzweifelhaft weiter entwickeln und
vervollkommnen, weswegen das von der Synode beschlossene Dokument auch die
Bezeichnung "Grundlagen" trägt.
In vielem hängt die Zukunft der Kirche davon ab, ob wir die aus dem Glauben
entstandene Lebenssicht in gesellschaftlich bedeutsamen Werken und in
überzeugenden Antworten auf die Probleme der Gegenwart umsetzen können, davon,
ob wir den Menschen beim Finden der richtigen Lebensprioritäten und im
Beschreiten eines echt christlichen Weges helfen können. Ich glaube, der Herr
wird uns unterweisen und führen und so das Werk des Heiles auch durch unsere
bescheidenen Anstrengungen vollenden.
Übersetzung aus dem Russischen: DDr. Johann Krammer
(Deutsche Zitate aus den "Grundlagen der Sozialkonzeption der Russischen
Orthodoxen Kirche" wurden weitgehend - manchmal mit leichten Abänderungen
- aus folgendem Werk übernommen: Die Grundlagen der Sozialdoktrin der
Russisch-Orthodoxen Kirche. Deutsche Übersetzung mit Einführung und Kommentar.
Herausgegeben von Josef Thesing und Rudolf Uertz. Konrad-Adenauer-Stiftung
e.V., Sankt Augustin 2001)
mehr zum
Thema ...
Osterbotschaft
des
Patriarchen von Moskau
und der ganzen Rus' Aleksij II.
an die
Bischöfe,
den Seelsorgeklerus,
die Angehörigen des monastischen Standes
und alle treuen Kinder der Russischen Orthodoxen Kirche
(2004)
An Deinem Kreuze hast Du den Fluch des Baumes vernichtet.
In Deinem Begräbnis hast Du die Macht des Todes getötet.
Durch Deine Erweckung erleuchtetest Du der Menschen Geschlecht.
Darum rufen wir zu Dir: Christus, unser Gnaden spendender Gott, Ehre sei Dir.
Stichira zu Psalm 140,
Vesper am Ostersonntag
Im Herrn geliebte Hochgeweihte Bischöfe, ehrwürdige Priester und Diakone, Mönche und Nonnen, liebe Brüder und Schwestern in Christus - treue Kinder unserer Heiligen Orthodoxen Kirche! Von ganzem Herzen beglückwünsche ich jeden von euch mit den so lange erwarteten und das Leben bekräftigenden Worten: CHRISTUS IST AUFERSTANDEN!
Von neuem jubelt unsere Kirche, nachdem sie die reinigende Fastenzeit vollendet hat, und den von den Toten auferstandenen Lebensspender Christus besingt. Lasst uns in unserem Herzen die reichen Früchte unserer Bemühungen der Heiligen Vierzig Tage bewahren, um nach den Worten des heiligen Apostels Paulus "das Fest nicht mit dem alten Sauerteig zu feiern, nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit den ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und Wahrheit" (1 Kor 5, 8).
Nach den Worten des heiligen Athanasios des Großen hat der Herr "den Sieg über den Tod errungen . uns aber zusammen mit Ihm auferweckt, indem Er uns von den Fesseln des Todes befreit hat und uns statt des Fluches Seinen Segen gab, statt der Trauer Freude, statt der Klage das österlichen Frohlocken".
Der Erlöser ist auferstanden und nichts kann unseren Glauben an die Güte Gottes, unsere Hoffnung auf die Errettung und unsere Liebe zueinander erschüttern. Das Böse und die Sünde sind besiegt, der Himmel geöffnet, den Menschen wurde die allmächtige Gnade Gottes zuteil, und unsere Seelen versinken nicht mehr im Meer der irdischen Sorgen, der Trauer und des Kummers, Hass und Trennung verschwinden.
Das Licht der Auferstehung Christi erhellt unsere Herzen und verscheucht daraus die Finsternis des Unwissens und der Unvollkommenheit. In diesem Licht erfahren wir das Erbarmen und die Liebe des allgütigen Herrn. Und Gott gebe es, dass wir, da wir das Licht Christi einmal erfahren haben, dieses Lichtes für immer würdig sein und den Widerschein des Glanzes der Herrlichkeit Gottes in unserem Herzen niemals auslöschen mögen. "Ihr leuchtenden Kinder der Kirche!", wendet sich der heilige Filaret von Moskau an uns, "nutzt das Licht, das der auferstandene Herr so reich auf euch ausgießt!"
Meine Lieben! Möge das Licht unseres Glaubens all jenen leuchten, die die Wahrheit und den Sinn des Seins suchen, die nach der göttlichen Liebe und Gnade dürsten. Lasst uns mit der Botschaft des auferstandenen Christus zu den Menschen gehen, mit guten Taten und Barmherzigkeit, und erinnern wir uns an das Gebot unseres Herrn und Erlösers: "So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen" (Mt 5, 16). Erfüllen wir unsere christliche Verpflichtung des Dienstes am Nächsten, indem wird versuchen, das Leben unserer Familien, der kleinen Hauskirchen, in denen unsere Kinder aufwachsen, mit dem Licht Christi zu erfüllen. Lehren und erziehen wir sie am Beispiel der Heiligen, die in unserer Heimat so zahlreich erstrahlt sind, denn durch ihre Fürbitten sind Not und Zwist oftmals von unserer Heimat abgewendet worden.
Am heiligen Ostertag schenkt uns der Herr Sein großes Erbamen, indem Er uns das Gnadenvolle Feuer aus Seinem lebensspendenden Grab schickt. Orthodoxe Christen aus der ganzen Welt, die durch die Gnade Gottes die Lichte Auferstehung Christi an diesem heiligen Ort begehen, empfangen voneinander dieses heilige Feuer und tragen es in alle Städte und Dörfer. Lasst uns auch miteinander das Licht und die Wärme des heutigen Festes teilen.
Bringen wir sie dorthin, wo man Gott nicht kennt, wo geistige Finsternis und Kälte herrschen. Erhellen und erleuchten wir jene, die heute an Armut, Krankheit, Krieg und Verbrechen leiden. Richten wir unseren Ostergruß an Menschen anderen Glaubens und anderer Überzeugungen, und denken wir daran, dass wir uns zusammen mit ihnen für ein besseres Leben einsetzen sollen. Lasst uns um die geistliche und materielle Wiedergeburt unserer Gesellschaft mühen, damit das Licht Christi unser ganzes Leben erleuchten möge.
Wieder und wieder beglückwünsche ich die Hochgeweihten Bischöfe, die Gottgeliebten Kleriker, den Mönchs- und Laienstand der Russischen Orthodoxen Kirche in der Heimat und in der Zerstreuung zum lichtvollen Fest der Auferstehung Christi. Ich beglückwünsche unsere Brüder und Schwestern - die orthodoxen Christen der ganzen Welt.
Ich sende meinen Gruß an die Bischöfe, den Klerus und das Volk der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland, mit der gemeinsam wir uns die Wiederherstellung der Koinonia und der Einheit bemühen. Ich teile die Osterfreude mit allen, die heute - in Ost und West - am selben Tag die Lichte Auferstehung Christi feiern.
Noch einmal beglückwünsche ich euch von ganzem Herzen, meine Lieben, mit den ewig lebendigen und das Leben bekräftigenden Worten, die vor mehr als 2000 Jahren als Zeichen der Hoffnung erklangen: CHRISTUS IST AUFERSTANDEN! ER IST IN WAHRHEIT AUFERSTANDEN!
Übersetzung aus dem Russischen: Erzdiakon Viktor Schilowsky, DDr. Johann Krammer
Im Herrn geliebte Väter, Brüder und Schwestern! Christus ist auferstanden!
Heute feiert die gesamte christliche Welt die Auferstehung Christi. Heute herrscht in jeder Kirche, in jeder Familie Freude über den Herrn Jesus Christus, der um unserer Erlösung willen gelitten hat und auferstanden ist.
An diesem "Fest der Feste" hören wir den an uns gerichteten Jubelruf des heiligen Johannes Chrysostomos: "Tretet also alle ein in die Freude eures Herrn! Ihr Reichen und ihr Armen, jubelt miteinander. Ihr Enthaltsamen und ihr Trägen, ehrt das Fest. Ihr, die ihr gefastet habt und die nicht gefastet haben, freut euch heute. Der Tisch ist reich gedeckt, genießt alle. Niemand gehe hungrig fort. Genießt alle das Gastmahl des Glaubens. Genießt alle den Reichtum der Güte!"
Unter den zum Ostergottesdienst Versammelten sind solche, die die Kirche regelmäßig besuchen, aber auch solche, die nur an den großen Feiertagen kommen, und solche, die nur selten das Gotteshaus besuchen. Es gibt unter uns Menschen, die seit ihrer Kindheit glauben, solche, die im reifen Alter zum Glauben gekommen sind, aber auch solche, die den Weg zu Gott gerade erst betreten haben. Aber Gott macht keinen Unterscheid zwischen Glaubenden und Nicht-Glaubenden: Er glaubt an jeden Menschen. Er liebt jeden von uns, Er hört uns jedes Mal, wenn wir uns an Ihn wenden, und ist bereit, uns zu helfen.
Auch die von Gott Selbst gegründete Kirche ist immer bereit, jedem Menschen zu helfen. Wenn Sie es schwer haben, wenn Sie Leid oder Not haben, kommen Sie in die Kirche, beten Sie zu Gott, und Er wird Sie bestimmt erhören und Ihnen helfen. Aber vergessen Sie das Gotteshaus auch in den Augenblicken des Glücks nicht. Die Kirche soll Ihr geistliches Haus werden, wo Ihre Seelen gereinigt werden und das Leben durch die Gnade Gottes verklärt wird, die trotz aller menschlichen Unvollkommenheit wirkt, ungeachtet all unserer Sünden, Unzulänglichkeiten und Schwächen.
Bringen Sie Ihre Kinder in die Kirche, denn nach den Worten des Herrn ist "ihrer das Himmelreich" (Mt 19, 14). Glauben Sie nicht, dass es genügt, ein Kind zu taufen, damit es glücklich und gesund aufwächst; für sein geistliches Wohlergehen ist eine ständige Teilnahme am Leben der Kirche unumgänglich. Bringen Sie die Kinder zur Beichte und zur Kommunion, lesen Sie ihnen das Evangelium vor, lehren Sie sie zu beten, damit sie immer eine lebendige Verbindung zu Gott haben. Wenn Sie Ihre Kinder im christlichen Geist erziehen, können Sie sie vor vielen Versuchungen und Nöten bewahren, an denen die heutige Jugend zugrunde geht.
An diesem Tag der Freude beglückwünsche ich von ganzem Herzen alle Gläubigen der Russischen Orthodoxen Kirche, die auf dem Territorium Österreichs leben, - Russen, Ukrainer, Weißrussen, Moldawier, Österreicher und Vertreter anderer Nationalitäten, aber auch die Mitglieder der georgischen Gemeinde, die unsere Kirchen besuchen.
Ich beglückwünsche die Gemeindemitglieder der Kathedrale zum heiligen Nikolaus - dem geistlichen Zentrum unserer Diözese. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden in unserer Kirche weitläufige Restaurationsarbeiten durchgeführt. Wir haben nicht wenig vor zu tun, sowohl bei der Restaurierung als auch auf dem Gebiet der Entwicklung des Gemeindelebens. Liebe Gemeindemitglieder der Kathedrale! Wenn Sie den Wunsch haben zu helfen, wenden Sie sich an den Priester und sagen Sie es ihm: Jede Initiative, jeder Vorschlag wird mit Dankbarkeit angenommen werden.
Herzlich beglückwünsche ich die russisch-orthodoxen Gläubigen in der Steiermark. Lange Zeit haben Sie keinen ständigen Priester gehabt, aber jetzt wurde für die Gemeinde Mariä Schutz in Graz ein Priester ernannt, der regelmäßig die Gottesdienste feiern und Ihnen bei der Errichtung und Festigung der Gemeinde helfen wird.
Ich wende mich mit meinem Grußwort auch an die Gläubigen unserer Kirche, die in Innsbruck leben, wo in diesem Jahr zum ersten Mal ein Ostergottesdienst gefeiert wird. Ich hoffe, dass mit Gottes Hilfe auch in Tirol regelmäßig Gottesdienste stattfinden werden, aber dazu bedarf es vor allem Ihrer eigenen Initiative und Ihres Wunsches nach einem vollwertigen kirchlichen Leben.
Geliebte Kinder unserer Heiligen Kirche! Die Gegenwart und Zukunft der Russischen Orthodoxie liegt in unseren Händen. Seien Sie deshalb nicht passive Gläubige, die ihre christlichen Pflichten sofort nach dem Gottesdienst vergessen, sondern aktive Mitglieder der Kirchengemeinde, die ihren Beitrag in das Werk der Errichtung der Kirche Christi einbringen. Nicht nur Sie brauchen die Kirche, sondern die Kirche braucht auch Sie. Die Kirche existiert durch Sie, dank Ihrer Teilnahme an ihrem Leben, dank Ihrer geistigen, moralischen und materiellen Unterstützung. Jeder von Ihnen hat etwas, was er mit der Kirche teilen könnte: der eine hat materiellen Reichtum, ein anderer Freizeit, ein dritter Talente und Fähigkeiten, die er zum Nutzen der Kirche einsetzen könnte. Vergraben Sie Ihr Talent nicht in der Erde, setzen Sie es ein, damit es hundertfachen Nutzen bringe und das Leben vieler Menschen in Ihrem Umkreis verändere.
Meine Lieben! Hören wir in dieser lichten Osternacht den an uns gerichteten Aufruf des heiligen Apostels Paulus: "Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch!" (Phil 4,4). Die Freude über die Auferstehung Christi möge nie aus Ihrem Herzen weichen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Nahestehenden Frieden, Freude und Wohlergehen. Der Segen des Herrn sei mit euch allen. Christus ist auferstanden!
Übersetzung aus dem Russischen: Erzdiakon Viktor Schilowsky, DDr. Johann Krammer
Bischof Hilarion von Wien und Österreich
Die Kirche existiert, dem Himmel zugewandt auf der Erde, sie lebt in der Zeit und atmet doch zugleich Ewigkeit. Ewigkeitswert liegt auch dem kirchlichen Kalender und allen Gottesdiensten des Jahres-, Wochen- und Tageskreises zu Grunde. Im Rahmen eines Jahres gedenkt die Kirche des Schöpfungsplans und erlebt die gesamte Welt- und Menschheitsgeschichte in der göttlichen Heilsabsicht zur Rettung der Menschheit. Im Jahreskreis der Feste läuft das Leben Christi vor unseren Augen ab - von seiner Geburt bis zur Kreuzigung und Auferstehung, das Leben der Gottesmutter - von ihrer Zeugung bis zu ihrem Entschlafen, das Leben aller durch die Kirche verherrlichten Heiligen.
Im Laufe einer Woche und einer Tageseinheit wird diese Geschichte wiederum vergegenwärtigt in den Gottesdiensten. Jeder Kreis hat ein Zentrum, an dem er sich orientiert: Mittelpunkt des Tageskreises ist der Gottesdienst der Eucharistie, Zentrum des Wochenkreises ist der Auferstehungstag und Zentrum des Jahreskreises das Fest der Auferstehung Christi, Ostern.
Die Auferstehung Christi war das bestimmende Ereignis in der Geschichte des christlichen Glaubens. »Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich«, schreibt der Apostel Paulus (1. Korinther 15,14). Wäre Christus nicht auferstanden, wäre das Christentum lediglich eine von vielen Morallehren und religiösen - Weltanschauungen geworden, vergleichbar dem Buddhismus oder dem Islam.
Die Auferstehung Christi legte den Grund der Kirche durch neues Leben und ein neues gottmenschliches Sein, in welchem der Mensch Gott wird, weil Gott Mensch wurde. Das Fest der Auferstehung Christi war, solange es Kirche gibt, der Eckstein des christlichen Kalenders.
Die kirchlichen Feste sind nicht nur einfache Erinnerungen an Ereignisse aus weit zurückliegender Vergangenheit. Sie wollen uns vielmehr mit in jene geistliche Realität hineinnehmen, die hinter ihnen steht und überzeitliche unvergängliche Bedeutung hat für einen jeden von uns. Jeder Christ nimmt Christus als seinen Erretter an, der - ihm zugut - Fleisch geworden ist. Deshalb werden alle Ereignisse im Leben Christi für einen jeden Christen zu einem persönlichen Erlebnis und Teil geistlicher Erfahrung. Das Fest ist also heutige Aktualisierung eines vor langer Zeit erfolgten Geschehens und ereignet sich immer wieder, zeitlos. Zu Weihnachten hören wir in der Kirche »Heute ist Christus in Bethlehem geboren«, zu Epiphanias (dem Fest der Taufe Christi im Jordan) - »Heute wird die Natur der Wasser geheiligt«, zu Ostern - »Heute hat Christus den Tod überwunden und ist auferstanden aus dem Grabe.« Wenn Menschen außerhalb der Kirche sich häufig an die bereits ihren Händen entglittene Vergangenheit halten oder hoffnungsvoll auf die noch bevorstehende Zukunft zugehen, so werden sie in der Kirche aufgerufen in einem »ständigen Heute« zu leben, d. h. in einer realen, »heute« erfolgenden und täglich sich fortsetzenden Gemeinschaft mit Gott.
Daher durchdringt das Fest der Auferstehung Christi, obwohl es nur einmal im Jahr begangen wird, das ganze Kirchenjahr, und österlicher Abglanz liegt auf dem gesamten liturgischen Kreis. Ostern oder Passah ist nicht bloß ein Kalenderdatum. Für den Christen ist Ostern immer, weil er stets die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus braucht. Der ehrwürdige Serafim von Sarow grüßte das ganze Jahr hindurch seine Besucher mit den österlichen Worten »Christus ist auferstanden«.
Philipp Harnoncourt, Graz
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit wohlriechenden Salben , die sie selbst zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab, in dem Jesus bestattet worden war. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen in das Grab hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Während die Frauen ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: "Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden! Erinnert euch doch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen." Da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den Elf und den anderen Jüngern. Es waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus; und auch die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten das alles für leeres Geschwätz und glauben den Frauen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden dort liegen.Dann ging er nach Hause - voll Verwunderung über das, was geschehen war. (Lukas 24, 1-12)
Das Evangelium der Osternacht, das eben vorgelesen worden ist - es ist wiederum vom Evangelisten Lukas geschrieben, wie das vom Palmsonntag und das vom Ostermontag -, spricht von einem Weg, wie diese beiden anderen.
Frauen gehen am dritten Tag nach dem Tod Jesu in aller Frühe zu seinem Grab, um ihm wenigstens noch jenen Dienst zu erweisen, der zwischen seiner Abnahme vom Kreuz und seinem sehr eilig vorgenommenen Begräbnis nicht mehr möglich war, ohne sich unrein zu machen.
Sie hätten am jüdischen Ostermahl nicht teilnehmen können, wenn sie nach Sonnenuntergang einen Leichnam berührt hätten, und außerdem war der folgende Tag auch noch ein Sabbat.
Jetzt aber wollten sie den Leichnam Jesu salben. Ihre große Zuneigung zu ihm kommt darin zum Ausdruck, dass sie selbst die wohlriechenden Salben bereitet hatten.
Niemand von den Menschen, die Jesus begleitet haben, erwartet ein Wunder. Er, auf den sie ihre Hoffnungen gesetzt haben, er, der Tote auferweckt hatte, er war jetzt selbst tot.
Die Repräsentanten der offiziellen Religion - die Ältesten, die Schriftgelehrten und die Hohenpriester - hatten seine Hinrichtung verlangt; ein aufgewiegelter Mob hatte lautstark seine Kreuzigung gefordert; und die Inhaber der politischen Macht - der bedeutungslose Schattenkönig Herodes der Jüngere und der römische Statthalter Pontius Pilatus hatten schließlich zugestimmt.
Wie eine riesige Seifenblase war das vielversprechende Wirken Jesu geplatzt und vernichtet.
Die Männer, die zu Jesus gehört hatten - seine Apostel und die übrigen Jünger - waren zwar anscheinend noch irgendwo in Jerusalem beisammen, aber ein Gang zum Grab lag ihnen fern. Zu groß war ihre Enttäuschung, vielleicht sogar ihre Verbitterung darüber, einige Jahre mit diesem Wunder-Rabbi vertan zu haben. Manche hatten schon von ihren großen Karrieren in seinem geträumt.
Einige machen sich schon bereit, um diesen Kreis schleunigst zu verlassen.
Wir haben auch heute - ebenso wie schon am Palmsonntag - zu beachten, dass die Evangelisten ihre Berichte nicht in den Tagen der geschilderten Ereignisse niedergeschrieben haben, gleichsam als Protokoll des Geschehens, sondern erst viel später, als sie bereits Zeugen des Glaubens an die Auferstehung Christi waren.
Umso erstaunlicher ist es, in wie schlechtem Licht sie sich selbst darstellen.
Die Frauen kommen allerdings etwas besser weg.
Wann immer in den Evangelien von Wegen gesprochen wird, auf denen sich etwas ereignet, gibt es neben dem oder hinter dem, was geschildert wird, etwas Besonderes zu beachten: einen Prozess - das heißt wörtlich einen Vorgang - der Glaubensbedeutung enthält. Glauben ist ja ein solcher Vorgang, eine Bewegung in einer bestimmten Richtung, gewissermaßen ein Sich-verlassen-auf. In jedem Vorgang bleibt etwas zurück, und Neues wird erreicht.
Der Weg der Frauen zum leeren Grab ist der zaghafte Beginn des Weges zum Glauben an die Auferstehung. Aber dieses Ziel ist noch weit entfernt.
Der Bericht lässt aber den aufmerksamen Hörer österliche Zeichen in manchen Bemerkungen erkennen. Die nachösterlichen Berichterstatter haben es nicht verabsäumt, verschlüsselte Hinweise auf die Auferstehung in ihre Texte einzubauen.
° Da ist einmal die Zeitangabe am Beginn des Berichtes: Am Ersten Tag der Woche. Der Erste Tag der Woche - nach unserer Wochentagsordnung immer der Sonntag - ist Gedächtnis des ersten Schöpfungstags, an dem Gott spricht: Es werde Licht!, und an dem der Schöpfer scheidet zwischen Licht und Finsternis. Die Erschaffung des Lichts, das Werk des ersten Schöpfungstages, ist vollendet im Sieg des ewigen Lichts über die Finsternis von Sünde und Tod. Für die Christen wird dieser Tag zu ihrem Urfeiertag, im Gedenken an jenen Tag, an dem Christus von den Toten erstanden und seinen Jüngern erschienen ist.
° Es folgt der Hinweis auf den Stein, der vom Grab weggewälzt war. Im österlichen Psalm 118 ist vom Stein die Rede, den die Bauleute verworfen haben, der aber zum Eckstein geworden ist, zum Stein des Anstoßes, zum Stein der zwei Wege scheidet, zum großen Prüf-Stein zwischen Leben und Tod.
° Das leere Grab weckt zunächst keinen Auferstehungs-Glauben; es lässt - wie später zu sehen und zu hören ist - verschiedene Deutungen zu: vom gestohlenen Leichnam bis hin zu dem der aus dem Scheintod erwacht und aus dem Grab geflüchtet ist, um irgendwo im Osten ein neues Leben zu beginnen.
° Zwei Männer in leuchtenden Gewändern traten zu den Frauen. Es sind zwei, das heißt, sie haben eine glaubwürdige Botschaft authentisch zu bezeugen. Und sie tragen leuchtende Gewänder, das heißt sie sind Boten des Himmels.
° Noch ehe sie den Frauen ihre Botschaft kundtun, stellen sie jene bedeutungsschwere Frage, die den unüberhörbaren Vorwurf mangelnden Glaubens enthält: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier! Als Gefolgsleute Jesu hätten sie doch wissen müssen, dass ihn der Tod nicht festhalten kann.
° Jetzt erst folgt die neue Oster-Botschaft Er ist auferstanden! und dazu die Ergänzung, dass er ja vorausgesagt habe, er werde gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen.
Anders als im Bericht von Matthäus und Markus findet sich bei Lukas keine Aufforderung an die Frauen, den Aposteln die Auferstehung Jesu mitzuteilen, aber sie gehen und berichten ihnen, was sie gehört und gesehen haben. Sie tun es beinahe ängstlich, als wären sie sich dessen, was sie erlebt haben, selbst nicht sicher!
Tatsächlich halten die Männer die Erzählung der Frauen für haltlose Phantastereien.
Allein Petrus macht sich auf den Weg, um sich selbst ein Bild vom Geschehen zu machen. Aber auch er kommt über eine große Verwunderung über alles, was geschehen war, noch nicht hinaus!
Der Weg zum leeren Grab, auch der Bericht vom leeren Grab und sogar der Lokalaugenschein beim leeren Grab führen noch nicht zum Glauben an die Auferstehung.
Erst der Auferstandene selbst - und nur er selbst! - bringt den Seinen die Gewissheit, dass er auferstanden ist.
Was für ein Trost für alle, die zweifeln - damals und heute!
aus:
Europaica
Bulletin of the Representation of the Russian Orthodox Church
to the European Institutions
Bulletin de la Représentation de l'Eglise Orthodoxe Russe
près les Institutions Européennes
All-Orthodoxe Begegnung im Heiligen Land
Botschaft der
Begegnung

Auf Einladung durch S.H. Patriarch DIODOROS von Jerusalem kam es zum
Weihnachtsfest nach dem julianischen Kalender zur Begegnung der Vorsteher fast
aller orthodoxen Kirchen aus aller Welt an den Heiligen Staetten in Jerusalem
und Bethlehem:
(von unten nach oben:)
Patriarch DIODOROS der Heiligen Stadt Jerusalem und Ganz Palästinas
Patriarch ALEKSIJ von Moskau und der ganzen Rus´
oekumen. Patriarch BARTHOLOMAIOS von Konstantinopel
Patriarch MAKSIM von Bulgarien
Patriarch THEOKTIST von Rumänien
Patriarch PAVLE von Serbien (nicht im Bild)
Patriarch ILIJA Katholikos von ganz Georgien (nicht im Bild)
Für das Patriarchat von Alexandreia: Metropolit Chrysostomos von Karthago
Für das Patriarchat von Antiocheia: Metropolit Johannes von Pergamon
Erzbischof ANASTAS von Tirana und ganz Albanien
Erzbischof CHRYSOSTOMOS von Zypern
Erzbischof CHRISTODOULOS von Athen und ganz Griechenland
Metropolit SAWA von Warschau und ganz Polen
Für die Kirche der Tschechischen Lande und der Slowakei: Bischof IOANN
und Metropoliten, Erzbischöfe und Bischöfe
aus der gesamten orthodoxen Welt
Im Zeichen des neuen Millenniums
Das
Treffen der Vorsteher der Orthodoxen Kirchen zum Weihnachtsfest in Bethlehem
Auszüge
aus einem Artikel von Nikolaus Thon
in Orthodoxie Aktuell
... Zum 1. Januar 2000 wurde weltweit in
vielerlei Weise der Beginn des dritten Millenniums unserer Zeitrechnung
begangen - sogar in den meisten Ländern mit nur einem äußerst geringen
christlichen Bevölkerungsanteil.
Viele dieser Feiern allerdings ließen kaum
erahnen, wer denn eigentlich den Beginn dieses Kalenders markiert, wer da von
unseren Vorfahren so sehr als Anfang eines neuen Äons empfunden wurde, dass man
nicht mehr nach den römischen Cäsaren oder der Gründung der Kaiserstadt am
Tiber die Jahre berechnen wollte, sondern nach der Geburt dessen, den man als
den Erstgeborenen der neuen Schöpfung ehrte, nämlich unseren Herrn Jesus
Christus.
Im Lärm der Neujahrsnacht ging auch in den
hiesigen Medien weitgehend ein Ereignis unter, das besondere Dimensionen
aufwies, nämlich das Treffen praktisch sämtlicher Vorsteher und zahlreicher
Gläubiger der Orthodoxen Kirche am Ort der Geburt Christi, in Bethlehem, das
dort am 25. Dezember nach julianischem Kalender, also am 7. Januar 2000 nach
neuer Zeitrechnung, stattfand. Einladender zu allen diesen Feierlichkeiten war
der Vorsteher der Kirche zu Jerusalem, Patriarch Diodoros.
Elf der 14 orthodoxen Kirchen aus aller
Welt waren durch ihre Vorsteher und Delegationen vertreten. Lediglich der
Patriarch von Antiocheia war - ebenso wie seine Bischöfe arabischer
Nationalität - aus politischen Gründen an einer persönlichen Teilnahme
gehindert. Kurzfristig seine Teilnahme absagen musste Patriarch Petros VII. von
Alexandreia, der an der Grippe erkrankt war, und es fehlte natürlich auch der
bisherige Vorsteher der Orthodoxen Kirche der Tschechischen Länder und der
Slowakei Metropolit Dorotej, der - nur einige Tage zuvor - im Alter von 86
Jahren gestorben war. Aber auch diese Kirchen waren durch hochrangige
Delegationen in Bethlehem vertreten.
Neben den Geistlichen Vorstehern der
Orthodoxie nahmen auch die politische Spitzen vieler mehrheitlich orthodoxer
Länder an dem Gipfeltreffen teil.
Der Patriarch von Moskau wurde nicht nur von mehreren Bischöfen, u.a. dem
Metropoliten von Kiev und der ganzen Ukraine Volodymyr, sondern auch von mehr
als 1000 Pilgern - Geistlichen, Seminaristen, Mönchen, Nonnen und Laien - aus
ganz Russland begleitet, so dem gerade zum Altpräsidenten des Landes gewordenen
Boris Jelzin, der mit seiner Ehefrau Naina und seinen Töchtern Tatjana und
Alina sowie einer Enkelin und einer Delegation von 150 Personen - darunter dem
russischen Außenminister Igor Ivanov und zahlreichen Sicherheitsbeamten -
anreiste (und bezeichnenderweise in den meisten Medien mehr Aufmerksamkeit auf
sich zog als alle Patriarchen zusammen!).
Der Einladung des Patriarchen von
Jerusalem gefolgt waren auch die Präsidenten Konstantinos Stephanopoulos von
Griechenland, Edvard Shevardnadze von Georgien, Emil Constantinescu von
Rumänien, Petru Lucinschi von der Moldau, Leonid Kutschma von der Ukraine und
Oleksandr Lukashenko von Belarus. Außerdem weilten der Präsident der
Palästinensischen Administration, Yassir Arafat, und der jugoslawische
Thronprätendent, Kronprinz Aleksandar Karadjordjeviç, mit seiner Frau Katarina
sowie Vertreter der Bundesrepublik Jugoslawien und der Republik Zypern der
Feier bei. Übrigens erhielten alle amtierenden Präsidenten, Altpräsident
Jelzin, sowie der Parlamentspräsident Bulgariens Sokolov, der Sondergesandte
Zyperns Kasoulidis und der jugoslawische Botschafter in Israel, Mirko
Stefanoviç, der Präsident Milosheviç vertrat, vom Patriarchen von Jerusalem die
höchste Auszeichnung, die seine Kirche vergibt, den Orden des Großkreuzes vom
Heiligen Grab.
...
Die in verschiedenen Hotels Jerusalems
untergebrachten einzelnen Delegationen absolvierten in den Tagen vor und nach
dem eigentlichen Treffen ein reichhaltiges Besuchsprogramm, das teils in
Besuchen bei den Einrichtungen ihrer eigenen Kirchen im Heiligen Land bestand,
teils auch andere Stätten einschloss; so weilte der Serbische Patriarch etwa in
Qumran, am Toten Meer und in Jericho, während Patriarch Aleksij II. die
verschiedenen russischen Klöster und Missionen besuchte.
Einen Schwerpunkt des Treffens der
Vorsteher der orthodoxen Kirchen bildeten natürlich die gemeinsamen
Gottesdienste etwa in der Auferstehungskirche zu Jerusalem, wo vor dem Grab des
Herrn eine kurze Doxologie gefeiert wurde, der der Ökumenische Patriarch
vorstand, der zuvor in griechischer Sprache das Evangelium von der Auferstehung
Christi verlesen hatte, das dann in kirchenslawischer Sprache noch einmal der
Moskauer Patriarch verkündete.
Den festlichsten Gottesdienst stellte
natürlich die Liturgie am Weihnachtstag in der Geburtskirche in Bethlehem dar,
also in einer Basilika aus der Zeit Kaiser Konstantins des Großen, die alle
Kirchenvorsteher gemeinsam mit etwa 40 Bischöfen, zahlreichen Priestern und
Diakonen feierten und bei der das Evangelium in vier Sprachen verkündet wurde,
nämlich in Griechisch, Arabisch, Kirchenslawisch und Rumänisch.
Das Ergebnis der den Gottesdiensten am 5.
Januar 2000 vorangegangenen gemeinsamen Beratungen der Vorsteher, in denen die
unterschiedlichen und oft doch recht ähnlichen Probleme in den einzelnen
Ländern angesprochen wurden, wird in ihrer Botschaft
deutlich, die sie an die ganze Welt gerichtet haben. Diese stellt nicht nur ein
unzweideutiges Bekenntnis zur Heilsbotschaft Christi dar, sondern verdeutlicht
auch, dass die Orthodoxie gewillt ist, tatkräftig an der Gestaltung des neuen,
des dritten christlichen Jahrtausends mitzuwirken. Besondere Aufmerksamkeit
erfuhr bei den Beratungen nach Auskunft des Sprechers des Patriarchats von
Jerusalem die politische Lage im Nahen Osten und die Wichtigkeit von
"Frieden, Stabilität und Brüderlichkeit zwischen den Völkern".
...
Man wird die Bedeutung des Treffens von
Bethlehems, gerade auch wegen der Einbeziehung der politischen Führer, als
gewichtig ansehen dürfen. Der britische Historiker Sir Stephen Runciman hat vor
einiger Zeit das neue Millennium als das "Jahrtausend der Orthodoxie"
bezeichnet. Dies triumphalistisch zu interpretieren, hieße, die Aussage misszuverstehen:
Sie ist vielmehr in dem Sinne zu interpretieren, dass die Orthodoxe Kirche sich
ihrer Aufgabe innerhalb der Gesamtchristenheit immer deutlicher bewusst wird,
wie dies vor kurzem der Erzbischof von Athen und ganz Griechenland
Christodoulos akzentuierte, wenn er sich für einen weiteren Dialog mit Europa
und gegen die "Introvertiertheit der Orthodoxen Kirche" ausgesprochen
hat: "Viele Europäer und viele Orthodoxe möchten, dass wir uns von Europa
verabschieden und unseren eigenen Bogen konträr zum Westen spannen. Das wäre
sowohl für den Westen wie auch für den Osten katastrophal". Auch im
Interesse des Westens sei es notwendig, einen Dialog der orthodoxen Christen
mit ihm aufzunehmen, denn angesichts der "geistlichen Krise" im
Westen müsse die Orthodoxie ihre Stimme einbringen.
Dies hat sie in Bethlehem getan: Es bleibt
nun abzuwarten, ob die Welt bereit ist, diese zu beachten.
Botschaft der Vorsteher der Orthodoxen Kirchen
aus Anlass des Beginns der Feier der zwei Jahrtausende seit der Geburt unseres
Herrn Jesus Christus im Fleische
1.
Wir, die mit Gottes Hilfe heute am 25. Dezember 1999 - 7. Januar 2000, am Fest
der Geburt unseres Herrn und Gottes und Erlösers Jesus Christus im Fleische,
durch Gottes Erbarmen versammelten und gemeinsam die Liturgie in der
Bethlehemer heiligen Kirche der Geburt des Herrn feiernden Vorsteher der
Heiligsten Orthodoxen Kirche senden aus der Höhle, die Gott aufgenommen, den
Friedenskuss allen unseren Brüdern und Konzelebranten überall in der Welt und
den Segen von Gott der ganzen Fülle der Einen Heiligen Katholischen und
Apostolischen Orthodoxen Kirche zusammen mit allen an Christus glaubenden
Menschen in aller Welt.
Freut euch immerdar, Brüder, über den Herrn, unseren Gott.
2.
Lob und Ehrpreis senden wir empor zu unserem in der Dreieinigkeit verehrten
Gott, der in seiner Macht Zeiten und Jahre gesetzt hat, dafür, dass er uns
gewürdigt hat, wohlbehalten dieses historische Datum der Menschwerdung unseres
Gottes zu erleben und an jenem Ort zu weilen, "wo seine Füße standen"
(Ps 131 [132],7), wo seine unermessliche Liebe um des Heils der Welt willen
"die Himmel geneigt hat und herabfuhr" (2 Kön 22,10).
Jetzt, an der Schwelle der Beendigung des zweiten Millenniums seit der Geburt
Christi steht die in der Überlieferung der Apostel und heiligen Väter
verbleibende Kirche Christi mit Ehrfurcht vor der unaussprechlichen
Menschenliebe Gottes, der in seiner Liebe sichtlich die Zeit von einem Träger
der Vergänglichkeit und des Todes umgewandelt hat zu einem Mittel des Lebens
und der Unsterblichkeit und von einem bloßen Anzeiger kalendarischer Wechsel,
der zur Ordnung des menschlichen Lebens eingerichtet ward, zu einer Erfahrung
der Ewigkeit.
3.
Für unseren orthodoxen Glauben erweist sich die Fleischwerdung des Sohnes und
Wortes Gottes in einer bestimmten Zeit und an einem konkreten Ort vor allem als
eine Heiligung der Geschichte und der Welt durch ihre Umgestaltung zum Reich
Gottes.
Die Zeiteinteilung nach der Göttlichen Fleischwerdung in einen Zeitabschnitt
vor der Geburt Christi und einen nach ihr erinnert den Menschen daran, dass von
jenem Tage an die Geschichte schon nicht nur vom Blickpunkt der Kräfte dieser
Welt, der politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Macht aus gedacht
ist und betrachtet wird, so als ob sie die Zeiten beherrsche, sondern vom
Blickpunkt des Reiches der Göttlichen Liebe, welche den Hauptgrund in der
Geschichte darstellt und deren Ankunft in der Zeit durch die Geburt des Herrn
vom Heiligen Geist und der Immerjungfrau Maria bezeichnet wird.
4.
Indem wir in der Erkenntnis dieser Wahrheit den Tag der Geburt des Herrn Jesus
Christus an diesem heiligen Ort seiner Erscheinung feiern, blicken wir in
Dankbarkeit gegenüber dem Herrn und ihrem Bildner auf die abgelaufene
zweitausendjährige historische Entwicklung der Kirche, denn durch den Heiligen
Geist hat er sie, die häufig bis auf das Blut bekämpft wurde, unversehrt
bewahrt - zur Bekräftigung seiner Worte, dass "die Pforten der Hölle sie
nicht überwinden" (Mt 16,18). Und wirklich war das historische Leben der Kirche
in diesem langdauernden Zeitabschnitt ein siegreicher Kampf mit den
verschiedenartigsten Feinden, sodass sie sich mit dem Apostel nichts anderem zu
rühmen vermöchte als ihrer "Schwachheiten" (2 Kor 12,5), sie, die
wortwörtlich wie mit "Purpur und Seide" geschmückt wurde mit dem Blut
ihrer Martyrer und benetzt wurde durch die "Ströme der Tränen" ihrer
ehrwürdigen Asketen.
Deshalb zeigt die Orthodoxe Kirche auch weiterhin der heutigen Welt das Kreuz
des Herrn, der "sanftmütig und demütig von Herzen" (Mt 11,29), der
einen jeden Menschen unabhängig von dessen Rasse, Hautfarbe, Geschlecht oder
anderer Unterscheidungsmerkmale liebt - und natürlich den sündigen und
"geringen Bruder", den die Mächtigen dieser Welt häufig zur
Erreichung ihrer Ziele opfern wie eine wertlose Sache.
5.
In dieser zweitausendjährigen Periode ihrer Geschichte hat die Kirche Christi
häufig auf Grund von Unglücken und wegen der Sündhaftigkeit ihrer Mitglieder,
der Hirten wie der Herde, Wunden davongetragen und den Außenstehenden dem Anschein
nach oder auch tatsächlich Anlass zur Kritik oder zum Auftreten gegen ihren
allheiligen Stifter und seinen heiligen Leib, "der die Kirche ist"
(Kol 1,24) gegeben.
Als tragischster Ausdruck dieser Tatsache erwies sich die in vielem vom
menschlichen Egoismus und anderen menschlichen Schwächen verursachte Spaltung
der christlichen Welt, die niemanden, der die Kirche liebt, gleichgültig lassen
kann, und natürlich auch nicht die Bischöfe, die von Gott zu Hütern ihrer
Einheit eingesetzt sind.
Die Schande der Spaltung der christlichen Welt, die wir auf Grund der
Gegebenheiten und der Geschehnisse der zweitausendjährigen Existenz der Kirche
geerbt haben, steht uns als eine klaffende Wunde vor Augen, um deren Heilung
unablässig zu beten und beständig zu sorgen und unermüdlich zu arbeiten wir
alle gerufen sind.
Gleichermaßen bedauern wir aufrichtig und tief die Existenz von Schismen
innerhalb unserer Heiligen Orthodoxen Kirche. Noch einmal verurteilen wir diese
Schismen und rufen alle Schismatiker auf, in den Schoß der kanonischen Kirche
zurückzukehren.
6.
Jetzt aber, da wir nach dem Ausdruck des Apostels Paulus das "hinter uns
Liegende vergessen und uns nach dem Kommenden ausstrecken" (Phil 3,13),
schauen wir auf das neue Jahrtausend mit Glauben an die Vorsehung, die Liebe
und das Erbarmen des allgütigen Gottes und sind uns gleichzeitig der
Vielfältigkeit der Probleme, der Zeitkrise und der Bedrängnis, der der heutige
Mensch ausgesetzt ist, bewusst.
Als Hirten der Orthodoxen Kirche, die immer dem Menschen in seinen Problemen
ein Helfer war, können wir all dem gegenüber nicht gleichgültig bleiben, was
das neue Jahrtausend dem Menschen bringt und in Besonderheit dem, dass es ihm
verspricht, wie ein scharf schneidendes Schwert die Probleme zu lösen und ihn vom
Unglück zu befreien, gleichzeitig aber mit neuen Nöten das Überleben des
Menschen als "Bild Gottes" und Schöpfung des "Guten"
bedroht.
Indem wir daher den menschgewordenen und auferstandenen Herrn als Sohn Gottes,
als den einzigen Erlöser des Menschen und der ganzen Welt, als Stifter seiner
Heiligen Kirche bekennen, predigen auch wir so die Buße als einzigen Weg des
Heils für jeden Menschen, für jede Zeit, für jede Epoche und in allen
Situationen, wie er sie gepredigt hat und wie dies unsere Väter wiederholt
haben.
7.
Die Tatsache, dass die derzeitige eucharistische Versammlung der Vorsteher der
Orthodoxen Kirchen an den heiligen Stätten Bethlehems vollzogen wird und so
unsere Einheit offenbar macht und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die
Liebe des himmlischen Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
empfängt, ruft uns dazu auf, mit gebeugten Knien und im Gebet den nahe
Stehenden wie den Fernen diese himmlische Engelsbotschaft zu verkünden, welche
in jener mystischen Nacht der göttlichen Geburt des Erlösers erklang:
"Ehre sei Gott in den Höhen und auf Erden Friede, unter den Menschen
Wohlgefallen!" (Lk 2,14).
Daher richten wir von diesem heiligen Ort den Aufruf an die Lenker dieser Welt,
dass sie den vielersehnten Frieden in dieser Region und für alle hier lebenden
Völker erlangen und stärken und die in Jahrhunderten geheiligte Ordnung, den
Status-quo, der heiligen Stätten achten. Eine Wallfahrt in friedlichen Zeiten
zu diesen allen Christen der Welt heiligen Stätten bedeutet einen besonderen
Segen und eine geistliche Aufmunterung in Christo und eine Erneuerung für jedes
christliche Bewusstsein, da wir dabei - gemäß der Erkenntnis der Väter des VII.
Ökumenischen Konzils - "den an ihnen aufgewachsenen, erschienenen und im
Fleische erkannten und uns von der Verirrung errettenden Christus, unseren
Gott" erfahren.
Da wir jetzt an dieser heiligen Stelle stehen, verspüren wir die Wichtigkeit
der Worte unseres heiligen Vaters Athanasios des Großen über den
menschgewordenen Herrn, "denn jener ist Mensch geworden, damit wir
vergöttlicht würden, und er ist uns im Leibe erschienen, damit wir eine
Vorstellung haben vom unsichtbaren Vater!"
8.
Von diesem geheiligten Ort und im Namen des Urhebers des Friedens, Jesu
Christi, rufen wir mit großer Liebe zu ihnen alle Völker und ihre Lenker dazu
auf, für eine Beendigung der Kriege und die Lösung der zwischen ihnen
auftretenden Unstimmigkeiten mit friedlichen Mitteln zu arbeiten, indem sie mit
allen Kräften den Geist der Versöhnung stärken und verbreiten.
Die Orthodoxe Kirche ist bereit, dabei mit den ihr zur Verfügung stehenden
Mitteln mitzuwirken, die bei weitem nicht politischen, sondern nur geistlichen
Charakters sind, damit die Religion aufhört, wie dies in der Vergangenheit
vorgekommen ist, ein Grund oder Vorwand für Kriege zu sein und sich stattdessen
als beständiger Faktor des Friedens und der Versöhnung erweist. Erfüllt von
diesem Geist wenden wir uns auch an die anderen großen Religionen, in
Sonderheit an die monotheistischen Religionen des Judentums und des Islam,
wobei wir planen, die allergünstigsten Voraussetzungen für einen Dialog mit
ihnen um der friedlichen Koexistenz aller Völker zu schaffen.
Auf der Basis der Lehre des Evangeliums und unserer heiligen Überlieferung
verwirft die Orthodoxe Kirche den Hass gegenüber anderen Überzeugungen und
verurteilt den religiösen Fanatismus, in welcher Gestalt er sich auch zeigen
mag.
9.
Außerdem reichen wir von diesem Ort und im Namen des Herrn Jesus, der
"sich hingegeben hat für das Leben und das Heil der Welt", herzlich
unsere Hand menschenliebenden Mitgefühls und der Hilfe all denen, die
irgendeiner Art von Diskriminierung ausgesetzt sind allein aus dem Grunde einer
natürlichen, sozialen oder kulturellen Verschiedenheit.
Das zu erwartende Bevölkerungswachstum im neuen Jahrtausend wird möglicherweise
eine Reihe neuer Probleme schaffen und die Koexistenz und das friedliche
Zusammenleben verschiedener Kulturen unersetzlich machen. Dies darf man
allerdings nicht auf dem Wege der Ausmerzung der spezifischen Besonderheiten
der Kulturen im Schmelztiegel einer gleichmacherischen und monolithischen
Globalisierung zu erreichen suchen.
Wir halten es auch für unerlässlich, die Aufmerksamkeit aller an Christus
Glaubenden auf die Erscheinung einer neuen Form des Götzendienstes zu lenken,
die darin besteht, dass Gewalt, Geld und Wohlergehen vergötzt werden, die dann
sinnloserweise drohen, im Leben der Menschen die Liebe des Dreieinigen Gottes,
die Freiheit, die Unwiederholbarkeit der menschlichen Persönlichkeit ebenso zu
verdrängen wie den Vorgeschmack der Teilhabe am ewigen Gottesreich als dem
einzigen wahren Sinn der menschlichen Existenz.
10.
Bewegt von dem hohen Gefühl der pastoralen Verantwortung für unserer Herde,
möchten wir das Praktizieren des Proselytismus von Seiten einiger
nichtorthodoxer Bekenntnisse und religiöser Gruppen in jenen Gebieten
verurteilen, wo im Verlaufe von Jahrhunderten die Orthodoxe Kirche Christi ihre
pastorale Sorge ausgeübt hat. Wenn sie nicht die existierende
kirchlich-kanonische Struktur, die Prinzipien der christlichen Moralität und
die elementare Ethik einer gegenseitigen Achtung und eines Verstehens auf echt
christlicher Ebene beachten, werden in ihrem Ergebnis unannehmbare Probleme die
Folge sein, die im neuen Jahrtausend zwischen diesen Christen selbst entstehen
werden. Wir nähren die Hoffnung, dass diese Kirchen und Gruppen die kanonischen
Rechte, die Freiheit und die Wahrheit einer jeden der orthodoxen Kirchen
achten.
11.
Das Nahen des dritten Jahrtausends seit Christi Geburt findet den Menschen
angesichts eines stürmischen wissenschaftlichen Prozesses, der unter Mitwirkung
der Technik die Befreiung von vielen Krankheiten und eine Verbesserung der
menschlichen Lebensqualität verspricht. Die Kirche begrüßt mit großer Freude
diese Anstrengungen, vermerkt aber auch die Gefahr, die in einem radikalen
Eingreifen des Menschen in die Strukturen und den Bestand der genetischen
Eigenheit der Lebewesen verborgen liegt, wie auch das Verderben einer
unbedachten und egoistischen Einmischung des Menschen in die natürliche Umwelt,
als deren Ergebnis das Gleichgewicht zerstört wird, das die Lebensfähigkeit
dieser Umwelt ermöglicht.
Angesichts dieser Gefahr rufen wir alle verantwortlichen Personen dazu auf,
dass sie der Freiheit und Einzigartigkeit der menschlichen Person und der
Integrität der göttlichen Schöpfung dienen, indem sie Grenzen ziehen, in denen
sich die Wissenschaft entwickeln kann.
Außerdem scheinen für das neue Jahrtausend große soziale Probleme besonders
gefährlich zu werden, unter denen schon jetzt Einzelpersonen wie ganze Völker
leiden. Dies sind etwa die Arbeitslosigkeit, sind Hunger und eine sich
ausweitende Kluft zwischen Reichen und Armen, eine grausame Form der Arbeit, der
Handel mit menschlichem Leben, unheilbare Krankheiten und schwere menschliche
Leiden.
Die Orthodoxe Kirche hält besonders die Lösung der kritischen Probleme für
wichtig, die die Jugend unserer Zeit von einer geistlichen Erziehung, von
Moralität und sozialer Orientierung abhalten, von der doch in vielem die
Zukunft der menschlichen Gesellschaften und der Menschheit überhaupt abhängt.
Die Hinwendung zu den "Begierden des Fleisches und den Begierden der
Augen" (1 Jo 2,16), zu einem fälschlich so genannten Verständnis von
Religionen und Ideologien, die Zunahme der Drogen und die unbedachte Abwendung
vom Leben in Gott zu einer wahnwitzigen Lebensform bringen einen Geist des
Niedergangs und rufen im Endergebnis einen vorzeitigen geistlichen und
biologischen Niedergang der Jugend hervor.
Die Fürsorge, Liebe und besondere pastorale Sorge der Kirche für die Kinder und
die Jugend sind - nach dem Beispiel des Segens und der Liebe des ewigen
Vorbildes für die Jugend, des Herrn Jesus, für sie - beständig und unwandelbar,
damit solchermaßen das Wirken der Jugend auf dem Feld des evangelischen
Glaubens und des Lebens in der Kirche zu einer süßen Frucht für die Welt werde.
Als selbstverständlich erscheint die Ausdehnung der Hirtensorge der Kirche auch
auf das gottgeschaffene Element der Familie, die immerdar und unbedingt auf der
Heiligkeit des geheiligten Mysterions der christlichen Ehe basiert.
Quell zur Inspiration, zur Kraft und zur Erleuchtung bei der Lösung aller
genannten Probleme ist das Licht des Evangeliums und das aktive Leben der
Heiligen unserer Kirche.
In diesem geistlichen Licht und mit Hilfe des Kriteriums der Achtung der
Menschenrechte auf internationaler Ebene ist es notwendig, die verwandten
Tendenzen der Reorganisation zu kontrollieren, mit deren Hilfe neue staatliche
Gebilde erreicht werden sollen, wobei die bestehenden entweder verschmolzen
oder mit schon existierenden Einheiten vereint werden sollen. Bei dieser
Entwicklung muss unbedingt der Willensfreiheit der interessierten Völker
Rechnung getragen werden und es dürfen weder Gewalt noch ihnen fremde Ideen
angewandt werden. Dabei verwerfen wir jegliche Tendenz zum Nationalismus oder
Rassismus, der danach strebt, die orthodoxe Ekklesiologie zu ersetzen.
12.
Brüder und Kinder im Herrn!
Dieser heilige Ort Bethlehem erstrahlt jetzt durch die Gnade des in der
Dreieinigkeit verherrlichten Gottes als Ort eines die ganze Welt umspannenden
geistlichen Interesses und richtet jetzt durch uns diese Botschaft der Einheit,
der Liebe, des Friedens und des Segens an alle Welt.
Die Pflicht eines jeden Christen ist es, diese himmlische Botschaft zu
empfangen, um das neue Jahrtausend mit reinem Herzen, mit Demut und Buße zu
beginnen. Mögen uns nicht Gefühle der Furcht und des Pessimismus bestürmen. Die
Botschaft der Apostel ist in diesem Fall die nützlichste und aktuellste:
"Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes
ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns
gegeben!" (Röm 5,5). Der Erlöser Christus schenkt den Menschen den Ausweg
aus einer jeden Notlage. Christus schenkt der Welt seinen Frieden, wie er
selbst es gesagt hat: "Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe
ich euch" (Jo 14,27). Christus ist der Heiland der Welt und eines jeden
von uns. "Es ist keine Rettung in einem andern, und es ist auch kein
anderer Name unter dem Himmel, der den Menschen gegeben wäre, in dem wir
gerettet würden" (Apg 4,12). Das Frucht bringende Wirken des heiligen
Gottes in der Welt erhöht die menschliche Ohnmacht, und "was den Menschen
unmöglich ist, ist Gott möglich" (Lk 18,27).
Wir orthodoxen Christen schöpfen die persönliche Wiedergeburt und die Heiligung
aus der Teilhabe am heiligen Mysterion der Göttlichen Eucharistie, in dem wir
teilhaftig werden des Leibes und Blutes des Herrn zur Nachlassung der Sünden
und zum ewigen Leben. Deshalb beugen wir jetzt bei dieser eucharistischen
Versammlung zusammen mit der ganzen Orthodoxen Kirche fromm unsere Knie vor dem
allmächtigen Herrn, der auferstrahlt ist aus der Höhle als die Sonne der
Gerechtigkeit, der in der Welt ein Vorbild des Lebens hinterlassen und uns am
Kreuz erlöst hat von der Knechtschaft des Feindes und uns durch seine
glorreiche Auferstehung das ewige Leben geschenkt hat.
Von diesem Ort der Geburt des Erlösers und Herrn ausgehend und immer zu ihm hin
wandernd beten wir und glauben, dass wir alle, wieder geboren im Heiligen
Geist, in das neue Jahrtausend eingehen werden. Brüder, "alles aus Gott
Gezeugte besiegt die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: unser
Glaube!" (1 Jo 5,4). Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch
allen.
Amen!
Der
Patriarch von Konstantinopel Bartholomaios
Für
das Patriarchat von Alexandreia: Metropolit Chrysostomos von Karthago
Für
das Patriarchat von Antiocheia: Metropolit Johannes von Pergamon
Der
Patriarch der Heiligen Stadt Jerusalem und Ganz Palästinas Diodoros
Der
Patriarch von Moskau und der ganzen Rus‘ Aleksij
Der
Serbische Patriarch Pavle
Der
Rumänische Patriarch Teoctist
Der
Bulgarische Patriarch Maksim
Der
Katholikos-Patriarch von ganz Georgien Ilija
Der
Erzbischof von Zypern Chrysostomos
Der
Erzbischof von Athen und ganz Griechenland Christodoulos
Der
Metropolit von Warschau und ganz Polen Sawa
Der
Erzbischof von Tirana und ganz Albanien Anastasios
Für
die Kirche der Tschechischen Lande und der Slowakei: Bischof Ioann
Aus dem Informationsdienst Orthodoxie aktuell , Nr.
01/2000
FEIERN und BESUCHE
"100 Jahre Hl. NIKOLAUS KATHEDRALE zu Wien"
S.E. Metropolit PHILARET von MINSK und
SLUTSK
Exarch von BELARUS (Weissrussland)
und
Juri LUSHKOV, Buergermeister der Stadt MOSKAU
("Moskauer Woche" in Wien)
(19.-22.9.1999)
 Mit
der Ankunft des Vertreters des Hl.Synods und des Patriarchen der Russischen
Orthodoxen Kirche des Exarchen des Patriarchen für Weißrußland und Metropoliten
von Minsk und Slutsk PHILARET am 19. September wurden die Feierlichkeiten zum
100-jährigen Jubiläum der russischen Hl.NIKOLAUS Kathedrale zu Wien
eingeleitet.
Mit
der Ankunft des Vertreters des Hl.Synods und des Patriarchen der Russischen
Orthodoxen Kirche des Exarchen des Patriarchen für Weißrußland und Metropoliten
von Minsk und Slutsk PHILARET am 19. September wurden die Feierlichkeiten zum
100-jährigen Jubiläum der russischen Hl.NIKOLAUS Kathedrale zu Wien
eingeleitet.
Der 20. September begann mit einem Besuch Seiner Eminenz in der Stiftung
"ProOriente". Präsident Stirnemann präsentierte zum Jubiläum
herausgegebene Buch "Russland und Österreich", in dem sich die
Beziehungen der beiden für das kulturelle Erbe Europas so wichtigen Staaten vom
16. bis ins 20. Jahrhundert wiederspiegeln. Vor allem die kirchlich und
diplomatisch relevanten Ereignisse von der Gründung des Moskauer Patriarchats
bis zum Besuch S.H. Patriarch ALEXIJ II. 1997 in Wien und Graz werden durch
Beiträge von österreichischen und russischen Autoren beleuchtet. Abgerundet
wird das gezeichnete Bild durch die Wiedergabe des vollständigen Textes aller
Ansprachen während des Besuches des Patriarchen, der Dokumente des Dialogs
zwischen Rom und Moskau 1991 bis heute sowie von Beiträgen aus den Symposien
und Irenischen Initiativen von Pro Oriente 1995 bis heute.
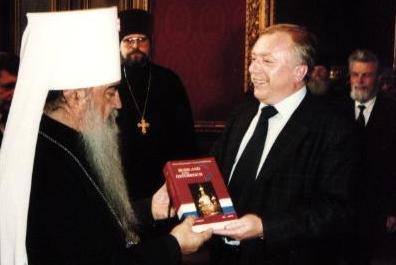 Um
15 Uhr wurde S.E. Metropolit PHILARET in Begleitung des Klerus und des
Pfarrvorstandes der Kathedrale vom Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien Mag.
Michael HÄUPL empfangen. Anknüpfend an das vom Metropoliten überreichte Buch
über die Kunstschätze Moskaus wurde die Aufnahme der Hl.NIKOLAUS-Kathedrale in
die Liste der Sehenswürdigkeiten Wiens und in die Programme für Wienbesucher
besprochen.
Um
15 Uhr wurde S.E. Metropolit PHILARET in Begleitung des Klerus und des
Pfarrvorstandes der Kathedrale vom Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien Mag.
Michael HÄUPL empfangen. Anknüpfend an das vom Metropoliten überreichte Buch
über die Kunstschätze Moskaus wurde die Aufnahme der Hl.NIKOLAUS-Kathedrale in
die Liste der Sehenswürdigkeiten Wiens und in die Programme für Wienbesucher
besprochen.
Danach wurde in der Kathedrale eine Panichida für die Stifter und Wohltäter des
Gotteshauses gehalten.
Die Woche "Moskau in Wien" begann um 18 Uhr am 20. September in
Anwesenheit des Moskauer Bürgermeisters LUSHKOV mit einer Veranstaltung zu
Ehren des 200. Geburtstags von A.C. Pushkin, dessen Denkmal in Oberlaa in
enthüllt wurde.
Abends begann im Schottenstift ein von der Stiftung ProOriente organisiertes
Symposium zum 70.Geburtstag des in Rom verstorbenen Metropoliten NIKODIM
(Rotow) vom damaligen Leningrad. Metropolit Philaret würdigte ihn im Sinne
seines Buches "Mann der Kirche". Es folgte ein Vortrag des polnischen
Professors Tadeusz KALUSHNI, der den Lebensweg des ehemaligen Metropoliten von
Leningrad und Freund der Kirche Roms nachzeichnete.
 Am Fest der Geburt der Allerheiligsten Gottesmutter,
dem 21. September 1999 wurde um 8 Uhr Seine Eminenz der Höchstgeweihte
Metropolit von Minsk und Slutsk, Exarch des Hl.Synods und des Patriarchen der
Russischen Orthodoxen Kirche für Weissrussland (Belarus) vor der Kathedrale offiziell
willkommen geheissen.
Am Fest der Geburt der Allerheiligsten Gottesmutter,
dem 21. September 1999 wurde um 8 Uhr Seine Eminenz der Höchstgeweihte
Metropolit von Minsk und Slutsk, Exarch des Hl.Synods und des Patriarchen der
Russischen Orthodoxen Kirche für Weissrussland (Belarus) vor der Kathedrale offiziell
willkommen geheissen.  Vor
dem Aufgang der Kirche erwarteten Bischof AWENIR, Auxiliarbischof der
Bulgarischen Orthodoxen Kirche sowie der Klerus mit dem Pfarrvorstand der
Kathedrale. Repräsentantinnen der Frauenchorgemeinschaft der Vertretung der Russischen
Föderation bei den Internationalen Organisationen in Wien begrüßten zunächst
S.E. Metropolit Philaret und später um 9 Uhr den Moskauer Bürgermeister
LUSHKOW, der begleitet vom Botschafter der Russischen Föderation in Österreich
W.M.GRININ und Mitgliedern des Stadtrates von Moskau bei der Kirche eintraf, in
traditionellen Kostümen mit Salz und Brot.
Vor
dem Aufgang der Kirche erwarteten Bischof AWENIR, Auxiliarbischof der
Bulgarischen Orthodoxen Kirche sowie der Klerus mit dem Pfarrvorstand der
Kathedrale. Repräsentantinnen der Frauenchorgemeinschaft der Vertretung der Russischen
Föderation bei den Internationalen Organisationen in Wien begrüßten zunächst
S.E. Metropolit Philaret und später um 9 Uhr den Moskauer Bürgermeister
LUSHKOW, der begleitet vom Botschafter der Russischen Föderation in Österreich
W.M.GRININ und Mitgliedern des Stadtrates von Moskau bei der Kirche eintraf, in
traditionellen Kostümen mit Salz und Brot.
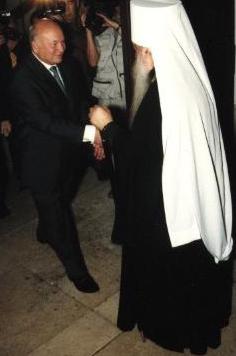 Vor Beginn des Gottesdienstes begrüßte Metropolit
Philaret den Moskauer Bürgermeister in der Kirche.
Vor Beginn des Gottesdienstes begrüßte Metropolit
Philaret den Moskauer Bürgermeister in der Kirche.
Dieser übergab als Geschenk der Stadt Moskau an die russische orthodoxe
Hl.NIKOLAUS-Kathedrale eine eigens dafür angefertigte Ikone des Hl.GEORG, des
Patrons der Stadt Moskau, der auch im Staatswappen der Russischen Föderation zu
sehen ist. Als Gegengeschenk wurde eine von CHRYSOSTOM Pijnenburg, einem Erzpriester
der Wiener Kathedrale, geschaffene Ikone des Hl.NIKOLAUS.
wird fortgesetzt

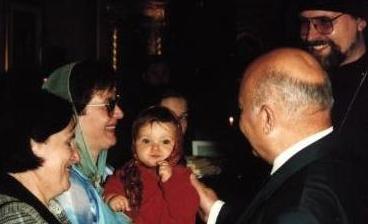
Heimgang
Seiner Eminenz des Hoechstgeweihten Metropoliten IRINEJ von WIEN und OESTERREICH






S.E. des Metropoliten KYRILL von Smolensk und
Kaliningrad, Vorsitzender des Aussenamtes des Moskauer Patriarchates in WIEN
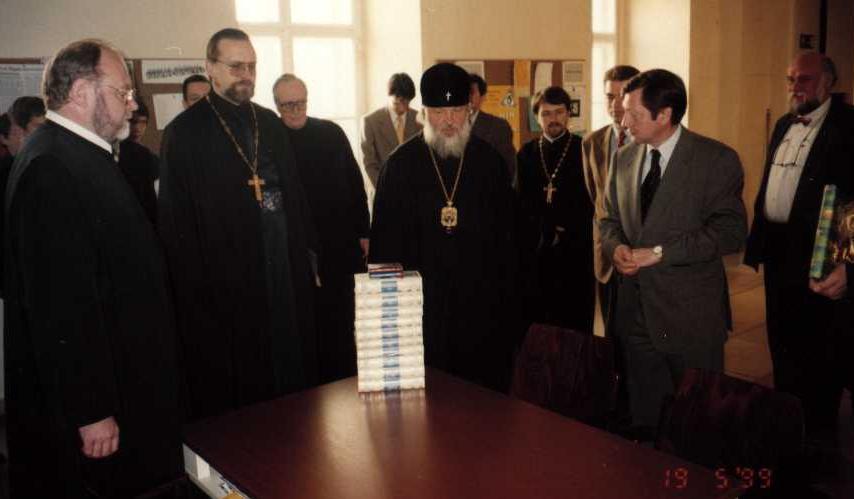

Die WELT auf dem KREUZWEG
S.H. Patriarch ALEKSIJ II.
zu den globalen gesellschaftlichen Prozessen und neuen moralischer
Herausforderungen an der Jahrtausendwende
Die
Jahrtausendwende veranlaßt die Menschen in der ganzen Welt über Geschicke ihrer
Völker, über den Sinn der Geschichte, über die Stellung des Menschen und
verschiedener menschlicher Gemeinschaften darin nachzudenken. Viele Ereignisse
in den letzten Jahren haben alte moralische Probleme zugespitzt und neue ins
Leben gerufen und waren der Grund für ungewohnte Fragen und Überlegungen.
Wie
schon vor vielen Jahrhunderten ist die Menschheit auch heute wegen des
unterschiedlichen Veständnisses für Moral und Recht und wegen des Verhältnisses
zwischen beiden Erscheiningen geteilt. Worin liegt die Grundlage von
Moralnormen, von denen wir uns in Politik, Wirtschaft, im Privatleben, in
zwischenmenschlichen, zwischennationalen und zwischenstaatlichen Beziehungen
leiten lassen müssen? Warum werden die gleichen moralischen Gesetze von den
Völkern verschiedenartig verstanden, verschiedenartig wahrgenommen und manchmal
sogar mißbraucht? Und was ist jetzt endlich die Moral? Sind das nur menschliche
Festlegungen, die von wechselnden Umständen abhängen, oder etwas mehr - ewige
Gebote des unabänderlichen Gottes, die nicht veralten, auch wenn die Welt sie
nicht mehr erfüllen wird?
Das
heute geltende Recht und die traditionellen moralischen Grundsätze können
manchmal in gewissem Widerspruch stehen. Der Begriff der "Sünde" in
der religösen Ethik ist mit dem Begriff des "Verbrechens" überhaupt
nicht in der Art zu identifizieren, wie er von den sekulären Gesetzen gedeutet
wird. Eine große Mehrheit von Handlungen, die vom Standpukt der uralten Moralnormen
unbedingt zu verurteilen sind, werden laut der Gesetze in den meisten Ländern
nicht bestraft. Welches Übel soll von Gesellschaft und Staat eingestellt werden
und welches wiederum ist aus Achtung vor menschlicher Freiheit zu dulden? Was
ist überhaupt das Kriterium "der Zulässigkeit" einer sündigen
Äußernung für die Gesellschaft? In der heutigen Welt ist es angebracht, als ein
solches Kriterium: z.B.: das Fehlen des augenscheinlichen Schadens für andere
Menschen zu halten (in der Regel ist es ein Schaden durch physischen und
materiellen Kategorien). Es ist aber nicht zu vergessen , daß es auch Werte
gibt, sei es für Gläubige als auch für viele Nichtgläubige, die für sie
unvergleichbar wichtiger sind, sogar wichtiger als das Menschenleben. Deshalb
dehnt sich für sie das Kriterium der Unzulässigkeit weiter aus.
Die
gesetzgebenden Systeme unterscheiden sich sowohl auf der nationalen als auch
auf der internationalen Ebene. Viele Rechtsprinzipien werden heute in Frage
gestellt und stoßen zusammen. Es reicht, den sich zugespitzten Widerspruch
zwischen dem Prinzip der Souveränität und der territorialen Integrität
einerseits und anderenseits den Interessen der einzelnen Bürgergruppen
andererseits zu erwähnen. Gerade dieser Zusammenstoß hat schon wiederholt zu massenhaften
blutvergießenden Konflikten geführt. Jetzt entsteht die Gefahr einer neuen
globalen Gegenüberstellung.
In
diesem ungelösten Fragenknäuel kann man zwei Probleme hervorheben. Das erste
ist die Beziehung zwischen der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit, dem
Frieden und der Wahrheit. Auf dem Schauplatz des internationalen Geschehens
tritt immer öfter der Konflikt zwischen den Versöhunungsidealen und dem Streben
hervor, eine gerechte Ordnung herzustellen. Diese Ordnung versucht alles
einzuschränken, das diesen oder jenen Vorstellungen von Wahrheit und Unwahrheit
nicht entspricht. Die Vorstellungen unterscheiden sich wie schon gesagt, stark
von einander. Das zweite Problem erstreckt sich auf die Spaltung zwischen dem
rein humanistischen Bewußtsein und dem religösen Bewußtsein. Das erstere hält
die materielle Existenz des Individums für den höchsten Wert. Das religiöse
Bewußtsein jedoch beharrt auf dem relativen Wert des irdischen Lebens und
echtes Ziel besteht darin, die ewige Glückseligkeit zu erreichen und sich
darauf vorzubereiten. Bei dem letzten Problem enstehet eine Frage über die
Möglichkeit des historischen Progresses. Der Christ, der die gottbegeisterten
Prophezeihungen vom apokalyptischen Ende der Geschichte nicht ignorieren kann,
nimmt natürlich die Behauptungen von dem Fortschritt der Menschheit ohne Gottes
Hilfe kritisch auf. Wenn es um die moraliscshe Einschätzung der Geschichte
geht, ist es also nicht einfach, sie als Fortschritt oder als Rückschritt
einzuschätzen.
Man
kann sagen, daß solche Betrachtungen wenig Gemeinsames mit der Realität der
globalen politischen Prozessen von heute haben. Es scheint, daß gerade tiefe
Unterschiede im Verständnis der Menschen und Völker für ihre historische
Mission zu jenen ernsthaften Widersprüchen führen, die heute in der Welt
geschehen. Die Situation um Kosovo herum, und die sich verstärkenden
Auseinandersetzungen des Westens mit Rußland, mit islamischen Völkern, mit
vielen Ländern der sogenanten "Dritten Welt", die mit großer
Anstrengung nach einem eigenen Entwicklungsweg suchen, läßt all das von
Gesetzmäßigkeit sprechen, deren Wurzeln viel tiefer liegen als geopolitische,
militärische oder ökonomische Interessen.
Der
Sturz des totalitären Regimes in der Sowjetunion hat einen neuen Enthusiasmus
der Ideologie des Fortschritts eingeflößt. Darunter versteht manim Allgemeinen,
die Bedürfnisse einer autonomen Person maximal zu befriedigen. Die vorgegebene
Ideologie zeigt sich im Konsumismus, der heute in den meisten Ländern der Welt
von Propaganda der "Ideale" des Konsums, beispielweise durch Reklame,
Ausbildung und politische Stereotypen aufgedrängt wird, und so jeden Versuch,
etwas über ökonomischen Interessen oder den Lebenskomfort zu stellen,
erdrücken. Aber der Konsumkult ist lediglich eine grobe Form des Kultes des
weltlichen Progresses. In der letzten Zeit sind wir öfter durch die Verbreitung
der Vorstellungen von einem irdischen Menschendasein betroffen, (dazu gehören
kulturelle, intellektuelle und andere ähnliche Aspekte), wie vom absoluten
Maßstab für Gute und Böse, dem höchsten Kriterium der Wahrheit und
Gerechtigkeit. Die ideale Gesellschaft ist laut gegebenen Vorstellungen
berufen, allen ihren Mitgliedern das Komfortleben im materiellen Sinn maximal
zu garantieren sowie Ausbildung, Zugang zu den intellektuellen Ressourcen und
abstrakte "geistig-kulturelle" Möglichkeiten zu geben. Die
Persönlichkeit hat keine Einschränkung auf sich zu nehmen, ausgenommen ernste
Forme von Angriffen auf andere Personen, die strafbar sind.
Im
gegebenen Wertsystem ist die Rolle der Gesellschaft zu einer einfachen
Staatsunterstützung herabgewürdigt, d. h. dem Mechanismus, der die Einhaltung
der "Spielregeln" in zwischenmenschlichen Beziehungen garantiert.
Die Einführung der gesetzgebenden Normen und
sich darbietende Möglichkeit, die Staaten und Gesellschaften zu ihrer
Einhaltung zu zwingen, soll den"vollen Triumph" der rationalistischen
Zivilisation aufzeigen, die nicht mehr Gott benötigt.
Natürlich
ist die Notwendigkeit, eines gewissen materiellem Lebensstandarts der Menschen
nicht zu leugnen, damit auch die Wahrnehmung ihrer Rechte und der Freiheit
garantiert sind. Die Sorge um einen guten Ernährungstzustand für sich und für
andere, der durch den Stadt gewährleistete Schutz des Menschen gegen Gewalt und
andere Angriffe seitens des Staates sowie die Schaffung von maximal günstigen
Bedingungen für die ökonomische, politische, kulturelle, geistige
Selbstverwirklichung gehört zu den würdigsten und moralisch rechtfertigten
Aufgaben. Ob der Inhalt unseres Daseins damit sein Bewenden hat? Ob darin der
Sinn der Existenz des Individuums und der Gesellschaft ist?
Wir
wollen nicht davon sprechen, daß das materielle Wohlergehen der ganzen
Menhscheit in dem Umfang, wie es der für die "goldene Milliarde" der
Bürger in den technologisch hoch entwickelten Ländern gerade zur Gewohntheit
geworden ist, kaum verwirklicht werden kann. Denn das Erreichen des Wohlstandes
wird im Widerspruch mit den realen ökologischen Ressourcen des Planeten stehen
und außerdem wird es von ökonomischer Ausbeutung der meisten Bewohner auf der
Erden begleitet, die für sehr schwere Arbeit einen miserablen Lohn erhalten.
Die egoistischen Interessen des Menschen ins Zentrum des Weltalls zu stellen,
ist nicht nur dem "siegenden " Konsumismus" sondern auch dem
"besiegten" Marxismus eigen. Das löst natürlich den Widerstand der
Menschen aus, deren Leben durch andere Werte bestimmt ist, die nicht in den
Rahmen des rationalistischen Verständnisses des irdischen Daseins passen.
Was
hindert die Serben, sich mit dem Verlust der geistigen Unabhängigkeit
abzufinden, sogar ihre alten Heiligen Stätten in Kosovo zu verlassen und nach
einer Zeit ein ruhiges und sättiges Leben zu erhalten? Warum versuchen
isalmische Völker auf ihrem Territorium eine für den Westen unbegreifbare
Ordnung herzustellen und sich der ganzen Welt gegenüberzustellen? Diese Ordnung
ergbit sich jedoch für sie natürlicherweise aus ihrer Religion und wird von
ihnen als gesellschaftliche Norm gesehen. Warum wohl viele Menschen in den
westlichen Ländern gegen moralischen Nihilismus protestieren und verzichten
sich, aus eigener Tasche Propaganda für Übel, für Abtreibungen oder für
Unterstützung der sogenanten sexuellen Minderheiten zu bezahlen? Worin liegt
eigentlich der Grund, daß sich viele unsere Landsleute schon einige Jahre
freundlich aber fest bemühen, dem Westen zu erklären: das Streben Rußlands zu
"ändern", indem man es veranlaßt, fremde weltanschauliche und
kulturelle Klischees aufzunehmen, und so unvermeidlich Abtrennung auslöst.
Jedes
Volk, jede Kultur, Religion und philosophisches System haben das Recht auf
historische Selbstrealisierung. Das gegenwärtige System des Internationalen
Rechtes gewährt ziemlich breit angelegte Bedingungen. Dennoch werden wir sehr
oft Zeugen beim Versuchs, eine der existierenden Weltanschauungen für gewisse
Universalnorm zu erklären und alle anderen als Abweichung von der Norm, die es
zu überwinden oder in anderer Weise zu nivellieren ist. Dabei vergißt man
jedoch, daß nur ein kleiner Bevölkerungsteil des Planeten real gesehen in der
Regel der "Norm" folgt. Es ist deshalb angebracht, bei den meisten
Völkern in Europa und in der Welt traditionelle Religionen und Bekenntnisse
vorzuziehen, die von der Hauptbevölkerung des Landes unterstützt werden. In
vielen Staaten wird der historischen Verbindung zwischen Volk und Religion,
Kultur und Lebensweise mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Gleichzeitig versucht man
uns ständig zu überzeugen, daß radikales Verständnis die Norm ist, die über dem
ethnischen und konfessionellen Staat steht. Jeder Versuch, nationale
Selbstidentifizierung in Glauben, Ethos und Kultur festzustellen, ist ein
Schritt zurück und Diskrimination der Minderheiten.
Heute
ist es auch angebracht vom absoluten, höchsten Wert zu sprechen. Gleichzeitig
ist deutlich, daß viele Menschen bereit sind, sich für ihre heiligen Begriffe,
Symbole und Vorstellungen aufzuopfern. Ein Versuch, die Priorität den rational
verstandenen Interessen zu geben und über das geistige Dasein der Nation zu
stellen, führt zu vielen Menschenopfern. Das Beispiel Kosovo zeigt anschaulich,
daß die Absicht einer Gruppe von Bürgern den Wohlstand auf Kosten der
Verletzung geistiger Prioritäten anderer Menschen zu schaffen, führte zu einer
schrecklichen Tragödie. Die Möglichkeiten, eigene Heiligtümer zu verehren,
bedeutet für die Serben mehr, als zeitweiliges irdisches Dasein. Wir
rechtfertigen nicht die Repressalien gegen ganz friedliche Albaner in Kosovo.
Es ist zu bemerken, daß dem serbischen Volk niemand das Recht auf gerechten
Kampf für die Integrität eigenes Landes, für den Zugang zu Heiligen Stätten
entzogen hat, auch wenn ein solcher Kampf eine gewalttätige Edrückung
bewaffneter Separatisten ist. Aber das Wesen des Kosovo-Konflikts ist aber
nicht nur im territorialen Besitz. Es sind zwei grundlegende weltanschauliche
Prinzipien zusammengestossen: Priorität der physischer Existenz des Menschen
und Priorität der geistigen Grundlage des Daseins. Die westlichen Teilnehmer
des Konflikts haben keine ernste Bedeutung dem zweiten Faktor beigemessen. Die
serbischen Handlungen werden durch geopolitischen Interessen des
"Belgrader Regimes" erklärt. Gerade dieses Unverständnis hat zur
heutigen Verwirrung im NATO-Lager geführt, sowie dazu, daß ursprünglich
deklarierte Ziele, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, genau ins
Gegenteil umgeschlagen sind. Etwas ähnliches passierte auch während der
tragischen Ereignisse in Tschethschenien. Die Elite Rußlands konnte sich nicht
vorstellen, daß weder militärische "Peitsche" noch ökonomisches
"Zuckerbrot" das Volk nicht veranlassen konnten, sich auf eigene
Identität, auf das Recht zu verzichten, um das Leben nach eigener Vorstellung
von Gute und Böse aufzubauen.
Ein
überzogener Individuallismus, der den Wert kollektiver Daseinsformen - Völker,
Nationen, religiöse Gemeinschaften-eher geringachtet, strebt auch danach, sich
als mehr "vorangige" Richtung des gesellschaftlichen Denkens zu
festigen. Aber dadurch ist die Enttäuschung sowohl im Westen als auch im Osten
zu sehen. Sogar diejenigen, die gewohnt sind, an den Menschen in den
Kathegorien der Einsamkeit angesichts Gottes, Natur, Gesellschaft und
Geschichte zu denken, müssen feststellen, Hunderte Millionen Menschen sind sich
dessen bewußt, daß das Leben der Person ohne enge Einheit mit anderen ärmer
wird. Zur höchsten und würdigsten Form persönlicher Selbstverwirklichung
gehört, sich selbst einzuschränken und in den Dienst am Nächsten - und so der
gesamten menschlichen Gesellschaften zu stellen.
Die
Ideologie, die heute auf Herrschaft und Universalität in den internationalen
Beziehungen Zuspruch erhebt, strebt auch danach, die Moralität in einen Teil
des Privatlebens des Menschen zu verwandeln und ihren gesellschaftlichen
Maßstab zu vermindern. Die Erscheinungen wie eheliche Untreue,
Geschlechtsabneigungen, Pornographie, Gewaltspropagande, Drogen und
Alkoholismus werden als Norm gesellschaftlichen Lebens erklärt, weil sie im
Bereich der Verantwortung des einzelnen Menschen selbst sind und die Interesseb
des physischen Wohlstandes andere Individuumen nicht betreffen. Wir wollen
nicht von anschaulicher Beziehung dieser Erscheinungen mit vielen
sozial-gefährlichen Erscheinungen sprechen: Kriminalität,
Familienzusammenbruch, Geschlechtskrankheiten. Es ist ein sehr ernstes Problem,
wenn erwähnte Läster im Widerspruch mit ewigen, moralsichen Normen stehen, die
nach Meinung von vielen ( wenn auch nicht der Mehrheit) von oben festgelegt
sind und deshalb die überzeugende Priorität gegenüber jeden menschlichen Gesetzen
und Beschlüssen haben.
Ob
Laster und Tugend zum persönlichen Leben der Bürger gehören? Ob der ethische
Bereich im Zusammenhang mit der hohen Ebene des gesellschaftlichen Konsens über
die eine oder andere Norm der Moralität zum Bereich der Sorge von Völkern und
somit auch des Staates geworden stehen muß? Ja, die tief religiöse Wurzel der
Ethik und dadurch auch ihr onthologisch-kathegorischer Charakter werden heute
überhaupt nicht von allen Menschen anerkannt. Aber die Natur des Menschen
protestiert gewöhnlich gegen Extrimität des ethischen Nihilismus. Das bebeutet,
daß demokratischen Gesellschaften natürlich die gesellschaftliche Moral in
eigenen Bestimmungen widerspiegeln müssen. Dazu kann die Verneinung des festen
Charakters und des übermenschlichen Wesens der ewigen moralischen Gesetze zur
Verschwommenheit axiomatischer Ethiknorm schließlich führen. Was für eine
Diskussion über die Legalisierung Pedophilie ist, wo die Gegner des Lasters
immer wieder mit großer Mühe die traditionelle Ethik mit Hilfe rein
humanistischer, rationaler, juristischer Argumente zu verteidigen versuchen.
Mit
wachsenden Auseinandersetzungen wird heute das Thema der Einmischung der
Wissenschaft und Technologie in die Natur von Pflanzen, Tieren und Menschen
besprochen. Ja, die Gentechnologie kann den Menschen mehr Lebensmittel geben,
einige Krankheiten vermeiden, das Leben des Individuums verlängern. Es zeichnet
sich ab, daß einige Schwierigkeiten praktischer Charakters früher oder später
überwunden werden können. Mit der Zeit wird die Angst wegen des Schadens
genetischer Technologien für physische Existenz des Menschen verringert. Ob es
zu vergessen ist, daß die Arbeit um die Nahrung willen, die Leiden und sogar
der Tod nicht unbedingt das böse Los ist? Warum halten wir irdisches Dasein für
absolutes Wohl, um wegen dessen willen wir meinten, das Recht zu haben, die
Welt Gottes nach eigener Betrachtung zu ändern?
Wir
haben nur einige der Fragen genannt, die heute akut vor der Menschheit am
Vorabend grosser Ablösung von historischen Meilensteinen stehen. In einem Sinn
können sie als neue gehalten werden. Aber ihr Wesen ist vielen Völkern und
Generationen schon seit dem Aufbau des babylonischen Turmes gut bekannt. Die
Menschen bemühen sich wiederholt zu beginnen, ohne Gott zu leben und stellten
ihren Verstand über den Willen des Schöpfers. Genauso ist es heute. Im
Hintergrund vieler Konflikte mit ökonomischem, politischem und sogar
militärischem Charakter steht und (wird bleiben) das Fehlen der Verständigung
zwischen den Trägern rationaler und religiöser Ansichten über Welt und
Menschen, Gang und Sinn irdischer Geschichte, sowie der Ansicht über die
Realität, die weiter und höcher als die Geschichte ist. Der enstehende
dramatische Bruch übt unmittelbar der Einfluß auf die Verständigung der
Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Frieden aus. Wenn die Menschen ganz
verschiedener Ansicht über Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit und Ungerechtigkeit
und Gesetzlosigkeit sind, ist es eine schwierige Arbeit, Feindschaft zu
überwinden und Frieden zu stiften.
Ob
es einen Ausweg in dieser Situation gibt? Ob es möglich ist, rationalistische
Weltanschauung und spirituelle Bestrebungen der Menschen in Einklang zu
bringen, die den menschlichen Verstand nicht für einziges Kriterium der
Wahrheit halten? Wir sind der Meinung, daß es nicht nur realistisch sondern
auch notwendig ist.
Als Grundlage zur Versöhung haben die sich
geistig orientierten Menschen wenigstens das Recht, damit zu rechnen, daß sich
rationalistischer "Mensch-Gott" auf Wahrheitsmonopolie, auf das
Streben, das Leben in Gesellschaft und im Staat sowie internationale
Beziehungen nur auf der Basis "objektiver" Werte von materiellen
Ordnung aufzubauen, verzichtet. Es lohnt nicht zu denken, daß die Werte, die
sich von Einstellungen des "postchristlichen" Humanismus
unterscheiden, apriori regressiv sind und deshalb nicht würdig sind, geachtet
zu werden. Gleichzeitig steht den religiösen Kräften bevor, deutlicher als
heute jene verschwommene Grenze zu spüren. Diese unterteilt das Recht des Menschen
einerseits, frei den eigenen Lebensweg zu bestimmen, indem der Mensch die von
Gott gegeben Wahlfreiheit zwischen Gute und Böse besitzt, und andererseits das
Recht in Gesellschaft, Nation und Menschheitsfamilie vielfältig und aktiv zu
unterstützen, was die natürliche und religöse Moral für Wohl hat. Gleichzeitig
werden keine Erscheinungen unterstützt, die laut Tradition als destruktif
gehalten werden. Gerade ein solcher Weg kann von einer großen Teil der
Weltbevölkerung bewillgt werden und die Harmonie in globale gesellschaftliche
Prozesse zurückgeben.
Andere
Methoden für Problemlösung, die heute in der Welt praktiziert sind, werden als
perspektivlos betrachtet. Wir meinen vor allem den Versuch, die Christenheit
ebenso wie andere Religionen in rationalistischer Weltanschauung zu verwischen.
Einige Jahrzehnte bemühen sich Glaubensgemeinden in vielen Ländern
notgedrungen, sich der Wirklichkeit eines gottlosen Milleus anzupassen. Eine
solche Anpassung stimmt nicht mit der Einhaltung des Willens Gottes überein,
sondern vielmehr mit Argumenten einer rein menschlichen Orientierung, deren
Wurzel außer religiöser Wahrheit sind. Das Ergebniss ist die Verringerung der
Religiösität und die Stärkung radikal pseudogeistiger Bewegungen, die sich
bemühen, eine Antwort auf die Sekulärisierung in den agressiven Protestformen
zu finden.
Wir
sind überzeugt, daß das Streben nach einem gerechten Frieden auf der Existenz
religiöser und sekulärer Ansichten beruhen, sowohl in der Entwicklung von Staat
und Gesellschaft als auch von Moral und ihrer sozialen Verwirklichung. Es ist
unmöglich, akute Probleme der Gegenwart lediglich auf der Grundlage
rationalistischer Sicht auf die Welt zu lösen, indem man sich bemüht, die
einzige gesellschaftlich-bedeutende Macht zu sein. Der menschliche Verstand
kann nur die geistig-moralische Krise der Zivilisation zu vertiefen. Man muß
humanistisches und theozentrisches Weltbild als gleichwertig akzeptieren und
beiden das gleiche Recht zugestehen, den Gang der Welt zu beienflussen. Nur so
werden die Bedingungen geschaffen, um durch Dialog und Zustimmung viele heutige
Trennungen zu überwinden, die viel Leiden gestiftet haben sowohl einzelnen
Ländern als auch in den Beziehungen zwischen den Völkern. Es ist zu wünschen,
daß die Zeit kommt, in der sich nicht nur in den Herzen von Gläubigen, sondern
auch auf dem globalen gesellschaftlichen Schauplatz " Güte und Treue
einander begegnen, Grechtigkeit und Frieden sich küssen" (Ps. 85, 11)
+
ALEXIJ
PATRIARCH
VON MOSKAU UND GANZ RUSSLAND


DIE UMSTAENDE EINER NEUEN ZEIT
S.E. Metropolit KYRILL von Smolensk und Kaliningrad
Vorsitzender des Aussenamtes des Moskauer Patriarchates:
Liberalismus, Traditionalismus und moralische Werte im sich vereinigenden
Europa
Dringe in die Umstände der Zeit ein, -
spricht der Hieromärtyrer Ignatios der Gottesträger. Dieses Vermächtnis ist
besonders heute aktuell; am Vorabend des Anfangs des dritten Jahrtausends.
Welche Probleme wirft vor uns das fortgehende Jahrhundert auf?
Worin liegt die Herausforderung unserer Epoche?
Das zu Ende gehende Jahrhundert rollt
akute Probleme auf, von deren erfolgreicher Lösung das weitere Schicksal der
Weltgemeinschaft abhängt. Die grundlegende Herausforderung der Epoche, in der
wir alle wohnen, besteht nach meiner tiefen Überzeugung in der Notwendigkeit,
ein zivilisiertes Modell der menschlichen Existenz im XXI. Jahrhundert
auszuarbeiten. Dieses Modell würde eine möglichst weitgehende Übereinstimmung
der dramatisch entgegengesetzten Imperative von Neoliberalismus und
Traditionalismus voraussetzen. Vor West und Ost steht die überaus schwierige
aber nicht hoffnungslose Aufgabe, gemeinsam das Gleichgewicht zwischen
einerseits dem Fortschrit im Bereich der Einhaltung der Rechte von Personen und
Minderheiten und andererseits der Erhaltung der national-kulturellen und
religiösen Identität von einzelnen Völkern zu suchen.
Überall
spürt man besonders scharf das Bedürfniss nach einer adäquaten und
solidarischen Antwort auf diese zivilisatorische Herausforderung unserer Zeit,
obwohl dieses Bedürfniss in den entsprechenden soziopolitischen und
kultorologischen Kategorien noch nicht formuliert ist. Kein deutlicher -für
viele aber dennoch real existierender- Hintergrund militärisch-politischer,
kulturell-religiöser, nationaler und anderer Gegenwirkungen, deren Zeugen wir
in der postkommunistischen Epoche sind, besteht gerade im Antagonismus der
konservativen Rückbesinnung und des traditionalistischen Ansatzes der
forcierten, wenn auch nicht gewaltsamen Ausbreitung neoliberaler Werte. Darin
liegt der innere Inhalt des ideelen Dramas unserer Zeit.
Das
XX. Jahrhundert war ein historischer Schauplatz, wo unversöhnliche Rivalen in
einer harten Bekämpfung paarweise einander abgelöst haben: Monarchie und
Republik; Faschismus und Kommunismus, Totalitarismus und Demokratie. Zwei
Weltkriege und ein "Kalter Krieg" ist das bittere Ergebnis
ideologischer Kompromißlosigkeit unseres ausgehenden Jahrhunderts. In diesem
Sinne wird jene Euphorie bei der Nachricht von der Umgestaltung im sowjetischen
System ganz natürlich und verständlich. Sie ergriff die ganze Welt, die durch
Balancieren von zwei Großmächten am Rande der atomaren Apokalypse ermüdet war.
Die
totale Herrschaft eines ideologisierten Bewußseins, das die Ausgeburt des
Stolzes und der Sophisterei des menschlichen Verstandes ist, zeugte immer
wieder vom eigenen Elend und brachte den Völkern ungezählte Leiden. Heute ist
dieses Bewußsein stark erschüttert. Die Konkurrenz der Ideologien wird durch
einen neuen und schwierig heilbaren Wettstreit ersetzt: Globalismus und
Universalismus als Ausdruck des Prinzips des Allgemein Gültigen gegen
Konservatismus und Traditionalismus als Ausdruck des Prinzips des Einzelnen und
Abgesonderten. Deshalb bleibt auch heute - wie in der biblischen Zeit - als
Grundstein der menschlichen Gemeinschaft das Prinzip, das von spanischen
Sozialdenker, Jose Ortega y Gasset, formuliert worden war: " Die
Zivilisation ist vor allem der Wille zur Koexistenz". Aber der Wille zur
Koexistenz setzt als verbindliche Bedingung voraus, das Recht des Anderen auf
sein Leben zu erkennen. Denn der Abglanz der Göttlichen Wahrheit trägt in sich
das Konzept der Rechte und Freiheiten des Menschen sowie das Prinzip der
national-kulturellen Identität, wenden wir uns an die Geschichte, um die
Genesis dieses aktuell gewordenen Gegensatzes zu verfolgen. Aber vor allem
wählen wir den Begriff des zivilisierten Standards. So werden wir sowohl den
liberalen als auch den traditionalistischen weltanschaulichen und axiologischen
Komplex beschreiben.
Es ist bekannt, daß die liberale Doktrin
im XVIII. Jahrhundert, Ende der Aufklärung, in Europa entstand. Im
darauffolgenden Jahrhundert wurde sie stark und festigte sich. Die
Revolutionsbewegungen, die gegen die damalige Staatsordnung in den Ländern von
Westeuropa und in Rußland protestierten, haben nicht selten die Idee der
allgemeinem Befreiung des Individuums ohne sozialen, politischen, nationalen,
religiösen, rechtlichen und anderen Einschränkungen benutzt. Die Anhänger
dieser Richtung postulierten als Fundamentalproblem dieser Epoche die
verfügbare Unfreiheit des Individuums. Dieses Individuum war versklavt und
durch Strukturen und staatliche Institutionen, soziale Ordnung, herrschende
Moral, Vorurteile und Bedingheiten unterdrückt. Folglich lohnte es sich, die
Person von Unterdrückung der Außenkräfte zu befreien, weil der Mensch
"laut seiner Bestimmung" ein absoluter und endlicher Wert sei und
sein Wohl - ein Kriterium der Gerechtigkeit gesellschaftlicher Ordnung. Am
Vorabend der russischen Revolution drückte der Klassiker der proletarischen
Literatur, Maxim Gorky, dieses Mythologem des liberalen Bewußseins in einer
konzertrierten Form aus. Er hat aus dem Munde seiner handelnden Person
verkündigt: " Der Mensch - das klingt stolz!" In der UdSSR wurden
diese Wörter auf dem Banner des antireligiösen Kampfes geschrieben. In einem
atheistischen Staat durfte es nicht um einem anderen Begriff gehen, dem eigene
Gedanke und Werke zu widmen wären. Nicht zufällig verbunden überzeugend noch
Holbach, Helvetius, Diderot und andere Philosophen der Aufklärung den
Humanismus mit Materialismus und Atheismus.
Der gottähnliche Mensch wurde in den Kern
des anthropozentrischen Weltalls als Maß aller Dinge hingestellt. Nicht einfach
als Mensch , sondern als der gefallene Mensch, versunken in der Sünde. Nach der
Kirchenlehre ist der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen, aber die Sünde hat die
Schönheit des Bildes verzerrt ( hl.Basilios der Grosse). Diese Vorstellung von
der verzerrten Menschennatur feht ganz in der gegenwärtigen westlichen
Mentalität. Darin triumphiert ein Komplex von Ideen, die von heidnischer
Herkunft sind. Diese Ideen begannen in der westeuropäischen Kultur in der
Renaissance sich zu festigen. Wenn das Konzept der Anthropozentrietät des
Weltalls gerade durch die Autorität der Renaissance geweiht wurde, wird das
Individuum als Sammelpunkt von Dasein und Sozium gemeint. Damit einher, dass
sich zusammen mit dem Rückkehr zu einer bestimmten Vorstellung der Kultur der
Antike in der Renassaince auch die spirituelle Involution des europäischen
gesellschaftlichen Gedankens von den christlichen Werten in regressive
heidnische Ethik und heidnische Weltanschauung zurückwendete. Beim Hinweis auf
den Ausdruck, womit Arnold Toynbee auf den Seiten seines fundamentalen Werkes
"Erreichen der Geschichte" wiederholt operiert, können wir mit gutem
Grund über den Triumph " des Götzendienstes in die noch lasterhaftere Form
der Anbetung des Menschen als sich selbst" sprechen.
Was das westliche Christentum betrifft,
hat es diesen Prozess überhaupt nicht verurteilt. Nachdem es das Postulat über
menschliche Freiheit als höchsten Wert seines irdischen Daseins als
sozial-kulturelle Gegebenheit angenommen haben, hat es den Bund von
neoheidnischer Doktrin mit christlicher Ethik geweiht. So wurde im Laufe der
Gestaltung des liberalen Standards christliche (durch den Katholizismus und
Protestantismus bestimmte) und heidnische Anfänge als übereinstimmend
definiert. Den bestimmten Einfluß hat hier auch ein ziemlich einflußreicher
theologischer jüdischer Gedanke in den westeuropäischen Institutionen ausgeübt,
der nach Holland und in angrenzende Länder (Maimonides, Crescas, Ibn Esra) durch
spanische Kultur und jüdische Migration gekommen war. Es ist kein Wunder, daß
die Ideen solcher Freidenker, Atheisten und Pantheisten, die sich vom
traditionellen Judaismus abgespaltet haben, wie Baruch Spinosa und zum Teil
Uriel Acosta durch liberale Weltanschauung im Laufe ihrer Formierung angewandt
wurden. Gegen Ende des XIX. Jahrhundert hat sich tatsächlich der ganze Komplex
von Begriffen gestaltet, die den liberalen Standart der Existenz beschreiben.
Der von der Großen Französischen Revolution ertsmal in der " Deklaration
der Rechte des Menschen und des Bürgers" konstituirte Liberale Standard
wurde schließlich in der "Gemeinsamen Deklaration der Menschenrechte
" vom 1948 verankert.
Es ist wirklich zu bedauern, daß Rußland
erst jetzt die Möglichkeit erhielt, sich an der Diskussion über das Verhältnis
von liberalen und traditionellen Anfängen zu beteiligen. Ja, die UdSSR hat
einst aktiv an der Ausarbeitung der gegenwärtigen Version des liberalen
Standard zwischenstaatlicher Beziehungen und Menschenrechte teilgenommen. Sie
hat das wegen pragmatischen Erwägungen getan: erstens, um die Beschuldigung des
Westens, totalitäre Methoden von Kontrolle und Verwaltung angewandt zu haben,
zu desavouieren, und zweitens, dieses zweischneidige Propagandaschwert bei der
ersten Möglichkeit auf ihre ideologischen Gegner zu richten. Damals hat man
gedacht, daß alle Verletzungen der Menschenrechte der Welt für immer hinter dem
eisernen Vorhang verschwiegen werden, und man es sich erlauben könne, einen
gewinnbringenden Kompromiß mit dem Westen einzugehen, um die Sympathien für den
Sozialismus zu verstärken. Man hat gehofft, etwas im eigenen inneren Leben real
zu verändern. Heute, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, ist von zwei
Supermächten auf dem Schauplatz des internationalen Geschehens nur eine
geblieben. Diese ererbte parodoxerweise nicht nur das ehemalige Sowjetreich,
sondern auch die Politik des Doppelstandards den Menschenrechten gegenüber. Wie
kann man erklären, daß das Problem von Kosovo der Anlaß zur Agression gegen Jugoslawien
war und das gleiche Problem von Kurdistan als Beweggrund zur Druckausübung in
bezug auf die Türkei überhaupt nicht betrachtet wird?
Es muß festgestellt werden, dass die
orthodoxe geistig-kulturelle Tradition leider aus ideologischen und politischen
Gründen von der sowjetischen Diplomatie überhaupt nicht vertreten wurde, als
die gegenwärtigen Standards der zwischenstaatlichen Beziehungen und
Menschenrechte ausgearbeitet wurden. Soweit ich es beurteilen kann, wurde sie
auch von Diplomaten anderer Länder des Ostens nicht genügend aufgezeigt. Mit
andern Worten kann man ganz bestimmt behaupten: die gegenwärtigen
internationalen Standards sind ihrem Wesen nach außerordentlich westlich und
liberalistisch. Dieser Umstand müsste nicht von besonderer Besorgnis sein,
hätte es sich um den außenpolitischen Bereich gehandelt, d.h. um
zwischenstaatliche Beziehungen, wo dieser Standard sich erfolgreich bewährt
hat. Wenn sich die Gültigkeit nur auf den Bereich zwischenstaatlicher
Beziehungen erstrecken würde, wäre das eine Absage an die universelle Natur des
liberalen Standards? Es ist ganz deutlich, was passiert wäre wenn an der Stelle
dieses universellen Standards der nationale Standard wäre, der in vergangenen
Zeiten wiederholt Kriege heraufbeschwört und legitimisiert hat. Wäre diese
Ersetzung nicht passiert, würde das ganze Weltsystem unkontrolliert zerfallen,
denn jeder von diesen Standards - sei es der zu zwischenstaatlichen Beziehungen
den Grund gelegte "vachchabitische", "chinesische", "afrikanische",
"katholische", "japanische", "hinduistische" und
so weiter- würde von den Trägern anderer nationalen, kulturellen und religiösen
Ansichten abgelehnt. Der Versuch, zwischenstaatliche Beziehungen anzubahnen und
dabei gewisse gemeinsame Prinzipien zu ignorieren, würde einer gemeinsamen
Katastrophe gleichkommen. In einer solchen Katastrophe bleibt keinen Platz für
Freude, wenn auch einer dieser Standards siegt, und sei es der eigene.
Folglich besteht das Wesen des Problems
nicht darin, daß der auf der Ebene internationaler Organisationen formulierte
liberale Standard heute der internationalen Politik zugrunde liegt, sondern
darin, daß dieser Standard auch von manchen als der notwendige für die
Gestaltung des inneren Lebens von Länder und Völker angesehen wird. Vor allem
wenn jene Staaten eingeschlossen werden, deren geistige und religiöse Tradition
tatsächlich in der Gestaltung dieses Standards nicht vertreten ist.
In diesem Zusammenhang ist es
erforderlich, mehr über die moralischen Werte des sich vereinigenden Europas zu
sagen. Es ist offensichtlich, daß diese Werte auch auf der Basis des westlichen
Liberalismus standardisiert sind. Solange die Grenzen des vereinigten Europas
mit den Grenzen Westeuropas zusammenfielen, konnte man das aufgezeigte Problem
als "innere" Sache des Westens betrachten, als seine eigene
zivilisatorische Auswahl. Die Verantwortung für diese Auswahl trugen in
pastoraler und religiöser Hinsicht die westlichen Kirchen. Heute dehnen sich
die Grenzen des vereinigten Europas nach Osten aus und es ist sehr
wahrscheinlich, daß in der nächsten Zukunft millionenstarke Länder mit
orthodoxer Bevölkerung zu Europa gehören werden. Was wird es für diese Länder
bedeuten, das Leben mit ihrer geistigen, kulturellen und religiösen Identität
entsprechend den für sie fremden ethischen und wertmäßigen Standards zu
bewahren? Wenn Europa und vielleicht die ganze Welt auf der Grundlage einer
einseitigen kulturell-zivilisatorischen Form unifiziert sein werden, wird es
wahrscheinlich leichter sein, sie zu leiten. Aber die Schönheit der Vielheit
sowie des menschlichen Glücks wird dort sicher nicht zunehmen. Hinzu ist es
heute ganz klar, daß die konfliktlose Expansion des Liberalismus, besonders in
jenen Bereichen des gesellschaftlichen Daseins, unmöglich ist, die sehr fest ihre
Werte beibehalten, anerzogen im Sinne der nationalen geistig-kulturellen
Tradition. Im Orient ist diese Erscheinung ziemlich offenbar, im Westen - nicht
so deutlich, obwohl sie da und dort real anwesend ist.
Die Geschichte der Annahme des neuen
russischen "Gesetzes über die Gewissensfreiheit und religiöse
Gemeinschaften " ist ein anschauliches Beispiel. Damals wurde ein
beispiellose politische Druck auf Rußland ausgeübt. Präsident Clinton und
Kanzler Kohl wendeten sich an den Präsidenten Eltsin mit Protestbotschaften,
der Papst von Rom forderte, daß der Kreml das neue Gesetz über die
Gewissensfreiheit blockiert. Die amerikanischen Kongreßleute bedrohten Rußland
mit wirtschaftlichen Sanktionen, wenn das Gesetzt angenommen wird. Was ist
geschehen? Warum hat dieses Problem, - ein innerrussisches Problem wie kein
anderes- solche negativen, scharfen und übereinstimmenden Reaktionen des
Westens ausgelöst ? Der Grund ist ganz einfach: unser Gesetz über
Gewissensfreiheit wurde als ein solches eingeschätzt, das dem liberalen
Standard im Bereich von religiösen Menschenrechten nicht entspricht. An diesem
Auftritt gegen die innere Gesetzgebung der souveränen Macht haben nur jene
Länder nicht teilgenommen, wo die Kirche - im Unterschied zu Rußland - den
staatlichen Status hat oder wo die formelle Registrierung exotischer Sekten,
die der heimischen Kulturtradition fremd sind, von mehr Bedingungen als bei uns
abhängig sind. Damals hat man von Rußland im Grunde genommen in ultimativer
Form gefordert, die nationale Gesetzgebung über die Gewissensfreiheit in
Einklang mit den internationalen, tatsächlich mit westlichen liberalen
Standards zu bringen.
Die ähnlichen Kollisionen, die die
Unvollkommenheit des liberalen Standards aufdecken und die Möglichkeit, mit ihm
für politische Zwecke zu manipilieren, sind sehr kennzeichnend. Mit der Zeit
werden sie immer mehr vor sich gehen, wenn man schon heute keine ernste
Diskussion über die Beziehung zwischen des Liberalismus und Traditionalismus
bei der Gestaltung von lebensfähigen Standards beginnt, die berufen sind, auf
die Herausforderungen nicht nur europäischer, sondern auch weltweiter
Integration zu antworten. Hieraus ergibt sich, daß in keiner Weise der
liberalste Standard aus allen möglichen im Verhältnis zu Freiheit und Menschenrechte
auf die Rolle eines allgemein anerkannten und echt universellen Standards
Anspruch erheben kann. Es kann ein solcher sein, der beim Postulieren des
Verzeichnisses von gewissen allgemeinverbindlichen Prinzipien organisch und
ohne Widerspruch die Vereinbarkeit mit national-kulturellen und religiösen
Wertorientierungen der Länder vorausgesetzt hätte, die ihn angenommen haben.
Die moralische Pflicht sowohl des postkummunistischen Rußlands als auch anderer
Länder mit der geistig kulturellen Tradition der Orthodoxie muß heute so
gestaltet werden, um eigene Vision des Problems der Weltgemeinschaft vorzulegen
und sie zur Erneuerung der Diskussion in den veränderten historischen Umständen
aufzufordern. Es steht eine große und schwierige Arbeit bevor, um eigene
Position angesichts der Weltgesellschaft in der UNO und in anderen
internationalen Organisationen zu formulieren und sich dafür einzusetzen. Die
Bemühungen Orthodoxer Kirchen können hier eine unschätzbare Rolle vor allem in
Rahmen des Dialogs mit anderen Kirchen, Denominationen und Religionen spielen.
In diesem Zusammenhang erlauben Sie einige Worte über Ökumenismus zu sagen. Ich
bin tief überzeugt, daß der Grund der Krise des gegenwärtigen Ökumenismus in
vieler Hinsicht verbunden ist mit seiner Unfähigkeit, die Fundamentalbedeutung
der Apostolischen Tradition als Norm des Glaubens zu verstehen. Diese Norm
zieht sich wie ein goldener Faden durch die Weltgeschichte und verbindet das
Apostolische Jahrhundert mit unserer Zeit. Sie bestimmt auch erschöpfend die
Wege des Lebens und der Rettung des Christen. Die Bewahrung und die Bestätigung
der unbeschädigten Norm ist die Mission des Glaubens der Orthodoxie in der
Welt, denn der Verzicht auf die Tradition in der Wirklichkeit automatische
Anerkennung bedeutet, daß dem Menschen alles erlaubt ist. Das Einverständnis
einiger christlichen Denominationen mit der Zulässigkeit der Frauenordination
oder der Segnung der homosexuellen Ehen ist im Grunde genommen nichts anderes
als praktische Verwirklichung des liberalen Standards der Menschenrechte und
einer grenzenlosen religiösen Freiheit. Das ist einer der vielen Fälle wo die
apostolische Norm des Glaubens konsequent und zielgerichtet aus dem Leben der
gegenwärtigen Gesellschaft verdrängt und durch den liberalen Standard ersetzt
wird.
Die Tragödie des gegenwärtigen
Protestantismus liegt in der Akzeptanz dieser Ersetzung christlicher Werte und
in ihrer Mitbeteiligung an diesen Tendenzen . Das führt dazu das nationale Bewußsein
zu verlieren und sich mit dem System der sekulären Welt zu vermischen. Gerade
in der ökumenischen Bewegung, und vor allem im Weltkirchenrat, ist diese Gefahr
für die Orthodoxen ganz offensichtlich geworden. Indem die Orthodoxen gegen die
Frauenordination und Anerkennung der homosexuellen Ehen protestieren,
protestieren sie gegen die Prinzipien selbst oder gewissen Prioritäten des
liberalen Standards (der ja wie ausgeführt im Wesentlichen auf
nicht-christlichen Wurzeln beruht). Gegen die Überordnung dieses Standards über
die Normen der Tradition der Bibel. In der Krise des Ökumenismus zeigte sich
das Streben der protestantischen Mehrheit, die liberalen Prinzipien zu
verbindlichen Grund-Prinzipien zu erklären und dadurch die ökumenische Ethik
und Praxis bestimmen zu lassen bei gleichzeitiger Unempfindlichkeit für das
Thema der Tradition. Das hat dazu geführt, daß Orthodoxe und Protestante
ungeachtet gewisser Erfolge beim Erreichen der Glaubenskonsense in neue
Trennungen geraten sind. Eine "Absolutisation" liberaler Standards
durch die protestantische Theologie war die Ursache für diese Teilungen.
Aber diese ernsthaften Differenzen und
Widersprüche dürfen nicht als Grund herangezogen werden, um den Dialog
abzubrechen, oder als Grund für religösen Kampf gegen den Westen. Im Gegenteil
hat die Russische Orthodoxe Kirche die Frage über die Krise des gegenwärtigen
Ökumenismus öffentlich und im Sinne brüderlicher Aufrichtigkeit gestellt. Sie
sieht in der Fortsetzung des zwischenchristlichen Dialogs die Möglichkeit, für
die getrennte Christenheit die grundsätzliche Bedeutung der Norm des Glaubens
das Zeugnis abzulegen, der in der Apostolischen Tradition erschienen wurde. In
dieser Hinsicht kann der Dialog mit Römisch-Katholischen Kirche erfolgreich
sein, die die Tradition als Norm des Glaubens anerkennt
Die monotheistischen Religionen sind treu
der Idee der Richtigkeit eigener religiösen Identität und verfechten hart die
Rechte ihrer Gläubigen, wovon entsprechende Artikel der Gesetzgebung von Israel
und moslemischen Länder ausdrucksvoll zeugen. Sie können auch als Verbundete
der Orthodoxen im Dialog mit denen auftreten, wer den Wert der Tradition
bezweifelt. Die unterschiedlichen national-kulturellen Standards sind nach dem
Wesen - so Karl Popper- "keine Feinde eines offenen Gesellschaft, wie man
manchmal sie vorzustellen versucht; aber im Gegenteil sind sie fähig, ein
wirksames Faktor ihrer Stabilität und Lebensfähigkeit zu sein.
Wir sind ständig vor das Dilemma gestellt:
entweder die Orthodoxie "sich ändert" oder durch
"Weltgemeinschaft" abgelehnt wird, unter derer Pseudonym sehr oft
eine der vielen existierenden heute Kulturen - die westliche, genauer gesagt,
die liberale auftritt. Sie wird beharrlich als die höchstprogressive",
"humanistische", "moderne" befestigt. Gleichzeitig werden
die Orthodoxie und nicht selten andere monotheistische Religionen dem liberalen
anthropozentrischen Wertsystem entgegengesetzt, erklärt für Norm für Individuen
und menschliche Gemeinschaften. Die Kirchen und religiöse Gemeinschaften sind
auf positive wie offensichtlich negative Aspekte des sich heute vollziehenden
Prozesses der Globalisierung entsprechend zu reagieren. Wir möchten andere
verstehen, aber wir wollen auch gehört und verstanden werden sein.
Indem wir aus der theozentrischen
spirituellen Tradition stammen, die den anthropozentrischen Humanismus als
fremdartige Sicht der Welt erkennt, sind wir zwar bereit, diese zu achten, aber
wir können sie nie als einen absoluten und bedingungslos positiven Wert
akzeptieren. Wir gehen auch davon aus, daß diese Standards direkt oder indirekt
zur Zerstörung der national-kulturellen und religiösen Indentiät der Völker
beitragen und unvermeidlich zur Verkümmerung der Weltfülle Gottes, ihrer
Unifizierung und schließlich zu ihrem Untergang führen.
Europa mit seinen Traditionen der
kulturellen Vielfältigkeit, Tolerenz und Offenheit könnte einen entscheidenden
Beitrag zum Prozeß der globalen Harmonisierung von religiösen, kulturellen und
soziopolitischen Traditionen beitragen. Die Christen sollen hier eine wichtige
Rolle spielen. Ich glaube, daß wir, alle mit gemeinsamen Bemühungen die
Grundlagen für eine echte vielfältige (vielpolare) Gemeinschaft mit den
Standards schaffen können, die die Freiheit- und Menschenrechte sichern und die
in geistig-kulturellen und religiösen Traditionen gewurzelten Werte nicht
zerstören sondern bewahren würden. Denn nur solche Weltgestaltung ist fähig,
eine reale Alternative zu Verdächtigungen, Feindschaft und Faustrecht in den
Beziehungen zwischen den Völkern zu werden.
"... Und leben und nicht sterben, wir
und du und unsere Kinder" (1.Mose 43, 8).
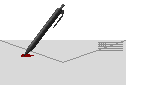
Russorthodoxvienna@MyChurch.com
Russische Orthodoxe
Hl. NIKOLAUS KATHEDRALE
Wien
Russorthodoxvienna@MyChurch.com
Letzte Aenderung:
15.02.2000
